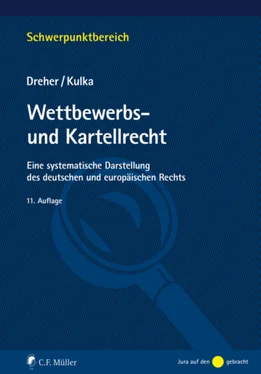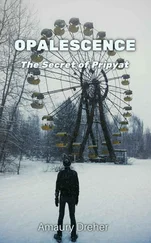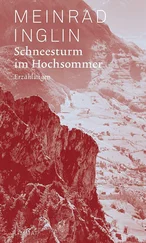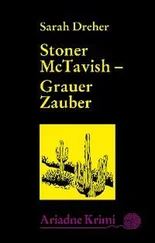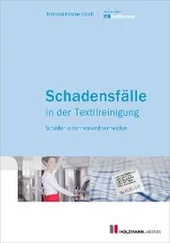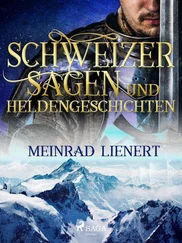1 ...7 8 9 11 12 13 ...45 [3]
Vgl. dazu unten § 12 Rdnr. 1404 ff.
[4]
Vgl. Rdnr 590 ff.
[5]
Vgl. zum Privatrechtsschutz im Kartellrecht unten Rdnr. 1909 ff.
[6]
Vgl. Rdnr. 578 ff.
[7]
Vgl. Art. 3 RegE eines Gesetzes für faire Verbraucherverträge, BR-Drucks. 18/21; Art. 1 Nr. 3 und Nr. 7 RegE eines Gesetzes zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht, BR-Drucks. 56/21. Dazu Rdnr. 579 ff.
[8]
Grundlage ist heute die VO (EU) 2017/2394.
[9]
Vgl. dazu Rdnr. 1785 ff.
[10]
Vgl. Wolf , WRP 2019, 283 ff; Köhler , WRP 2020, 803 ff; zu den damit verbundenen grundsätzlichen Problemen vgl. Fels , in: FS Jenny, Vol. I 2018, S. 243 ff.
[11]
Vgl. zu den unlauteren Handelspraktiken in der Lebensmittelversorgungskette die RL (EU) 2019/633 (dazu Glöckner , WRP 2019, 824 ff) sowie Art. 1 Nr. 16 RegE eines 2. Gesetzes zur Änderung des Agrarmarktstrukturgesetzes, BR-Drucks. 3/21.
[12]
Dazu Rdnr. 120 ff.
[13]
Dazu Rdnr. 427 ff, 493.
[14]
Dazu Rdnr. 123, 428.
[15]
BGH WuW 1962, 293 = WuW/E BGH 451 – Export ohne WBS; BGH WuW 1987, 649 = WuW/E BGH 2347 – Aktion Rabattverstoß.
[16]
Vgl. zu den Einzelheiten Rdnr. 1407 ff.
[17]
So aber Köhler , WRP 2005, 645, 646 f.
[18]
Vgl. Rdnr. 640 ffund 647 ff.
[19]
Köhler , WRP 2005, 645, 646. Aus dem gleichen Grund kann man das Unlauterkeitsrecht auch nicht als das allgemeine und das Kartellrecht als das besondere Wettbewerbsrecht ansehen; so aber Köhler , a.a.O. S. 646 f.
[20]
RegE UWG 2004, BTDrucks. 15/1487, S. 12 f. Zur Umsetzung der dem Verbraucherschutz dienenden UGP-RL: RegE UWG 2008, BTDrucks. 16/10145, und RegE UWG 2015, BTDrucks. 18/4535.
[21]
Beschlussempfehlung und Bericht des Wirtschaftsausschusses, BTDrucks. 18/11446, S. 26 f, 31 f.
Einleitung Rechtssystematische und rechtspolitische Grundlagen› II. Die Dominanz des EU-Rechts
II. Die Dominanz des EU-Rechts
1. Das EU-Recht als vorrangiges Wirtschaftsrecht
30
a) Das EU-Recht prägt, ungeachtet seiner Ausdehnung in andere Politikbereiche, vor allem das Wirtschaftsrecht. Seine Normen gelten grundsätzlich unmittelbar und gehen dem Recht der Mitgliedstaaten vor. Nach Art. 3 Abs. 3 S. 1 EU-Vertrag errichtet die Union „einen Binnenmarkt“. Dieser Binnenmarkt „umfasst“ gemäß dem „Protokoll über den Binnenmarkt und den Wettbewerb“, das nach Art. 51 EU-Vertrag Bestandteil des EU-Primärrechts ist, „ein System, das den Wettbewerb vor Verfälschungen schützt“. Diese Regelungen und Art. 101, 102 AEUV, die ebenfalls den Binnenmarkt in Bezug nehmen, sehen den Markt nicht als wirtschaftstheoretisches Abstraktum oder Modell, sondern als lebendiges mercatum, auf dem sich die Kaufleute und ihre Kunden nach den Regeln des Privatrechtsbegegnen.[1] Infolgedessen setzen die europäischen Verträge das überkommene Privatrecht der Mitgliedstaaten und dessen Institute, insbesondere die Vertragsfreiheit und das Eigentum, voraus und geben gleichfalls der privatautonomen Gestaltung der Einzelnen den Vorrang, lassen aber auch andere, d. h. stärker hoheitlich geprägte Ordnungen, etwa die Agrarordnung, zu.[2] Diese – rechtliche – Seite des Binnenmarktes wird häufig zugunsten einer ökonomisch-politischen Redeweise von Markt und Wettbewerb vernachlässigt, die jedoch nicht bis zu den institutionellen Voraussetzungen des „Marktes“ vorstößt.[3]
31
b) Um sein Ziel, den Binnenmarkt der EU-Bürger, zu erreichen, gibt der AEUV diesen die vier Grundfreiheiten, die sich vor allem gegen die staatlichen Beschränkungen richten: Er gewährleistet den freien Warenverkehr (Art. 28–37), den freien Personenverkehr, und zwar sowohl die Freizügigkeit der Arbeitnehmer (Art. 45–48) als auch die Niederlassungsfreiheit der Unternehmen (Art. 49–55), die Dienstleistungsfreiheit, also den freien Abschluss z. B. von grenzüberschreitenden Dienst-, Werk-, Versicherungsverträgen etc. (Art. 56–62), sowie die Freiheit des Kapital- und Zahlungsverkehrs (Art. 63–66). Folgerichtig verbietet er den Staaten grundsätzlich auch, durch Gewährung von Subventionen den Wettbewerb zu verfälschen (Art. 107).
32
Diese Grundpfeiler des EU-Wirtschaftsrechts haben die Vertragsänderungen in Maastricht (1992), Amsterdam (1997), Nizza (2000) und Lissabon (2009) überstanden. Zwar verfügt die EU seit einiger Zeit über erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten, über mehr „Politiken und Aktionen“ (Art. 175 AEUV), aber zugleich und zu Recht bremsen das Subsidiaritätsprinzipund der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz(vgl. Art. 5 EU-Vertrag) die Union stärker als bisher.
33
c) Das EU-Wirtschaftsrecht, das mit der Zeit immer schärfere Konturen gewonnen hat, zeichnet sich durch eine große Eigenständigkeitgegenüber den Rechten der Mitgliedstaaten aus. Es entwickelt auf der Grundlage der noch immer divergierenden Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten eigene Konzeptionen und Lösungen, dies nicht zuletzt in der Rechtsprechung des EuGH. Die Wettbewerbsordnung der EU unterscheidet sich deswegen in mancher Hinsicht auch von der Wettbewerbsordnung des deutschen Rechts. In der fundamentalen Bedeutung von Vertrag und Wettbewerb stimmen sie allerdings überein, wenn auch aus teils unterschiedlichen Gründen: Die EU kann jenseits der Gewährleistungen durch die GrCh anders weder den Binnenmarkt noch das Diskriminierungsverbot des Art. 18 AEUV verwirklichen (weil das Funktionieren von Vertrag und Wettbewerb am ehesten Diskriminierungen vermeidet); das deutsche Recht gewährleistet hingegen in den Grundrechten den prinzipiellen Vorrang der privatautonomen Gestaltung.
34
Heute dominiert das EU-Wirtschaftsrechtdas innerstaatliche Wirtschaftsrecht. Das einzelne nationale Wirtschaftsrecht bleibt allerdings im Zusammenhang seiner Rechtsordnung bestehen, auch wenn es in wichtigen Bereichen durch die EU harmonisiert wird. Der EuGH greift in das einzelstaatliche Recht nicht ein, wenn die Elemente eines Sachverhalts „sämtlich nicht über die Grenzen eines Mitgliedstaats hinausweisen“.[4] Die EU kann mithin keinen „vollkommenen Binnenmarkt“ gewährleisten. Umso mehr kommt es darauf an, die beiden wichtigsten Instrumente des EU-Wirtschaftsrechts, das Kartellrecht (Art. 101 ff AEUV) und das Beihilfeverbot (Art. 107 ff AEUV), konsequent anzuwenden. Einen großen Schritt in diese Richtung hat die VO Nr. 1/2003 getan.[5]
[1]
Vgl. schon Rittner , JZ 1990, 838, 839; ders. , in: FS Müller-Freienfels, 1986, S. 491 ff.
[2]
Vgl. a. EuGH, Slg. 1994, I-5039, I-5060, Tz. 59 = EuZW 1994, 690, Tz. 59 = NJW 1995, 945, 947 – Bananen, wo es heißt, dass „die Errichtung eines Systems des unverfälschten Wettbewerbs nicht das einzige in Art. 3 EGV genannte Ziel ist“.
[3]
Zu den rechtlichen Voraussetzungen marktwirtschaftlicher Ordnungen vgl. Rittner , WuW 1991, 95, 99 f.
[4]
Vgl. z. B. EuGH, Slg. 1980, 833, 855, Tz. 9 = NJW 1980, 2010 – Debauve; EuGH, Slg. 1991, I-2020, Tz. 37 = EuZW 1991, 349, 351 = NJW 1991, 2891, 2892 – Bundesanstalt für Arbeit.
[5]
Vgl. Rdnr. 636 ff.
35
a) Im europäischen Wirtschaftsrecht erfüllt das EU-Kartellrecht, das seit 1958 unmittelbar geltendes Recht ist, die Aufgabe, durch unmittelbar anwendbare Rechtsvorschriften den zwischenstaatlichen Handelinnerhalb des Binnenmarktes gegen Wettbewerbsbeschränkungen zu schützen. Die Art. 101 f AEUV, die das primäre EU-Kartellrecht enthalten, laufen schon infolge ihrer Stellung innerhalb einer umfassenden wirtschaftsrechtlichen Gesamtregelung viel weniger Gefahr, herausgehoben oder isoliert gesehen zu werden, als etwa das deutsche GWB. Sie stehen insbesondere in engem Zusammenhang mit den Grundfreiheiten, die das Kartellrecht ihrerseits erheblich entlasten. Zudem richten sie sich nicht nur gegen Wettbewerbsbeschränkungen durch Unternehmen, sondern – nach Art. 101 Abs. 1 AEUV i. V. m. Art. 3 Abs. 3, Art. 4 Abs. 2 und 3 EUV bzw. dem Protokoll über den Binnenmarkt und den Wettbewerb – auch gegen staatliche Maßnahmen, die wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen von Unternehmen i. S. d. Art. 101 und 102 AEUV erleichtern, fördern oder vorschreiben.[1]
Читать дальше