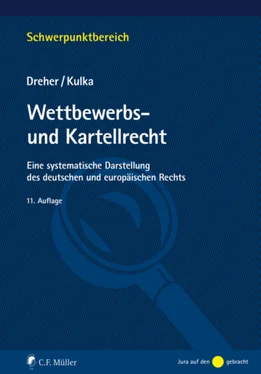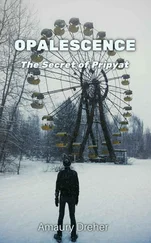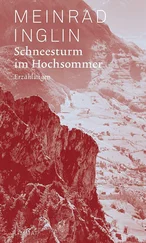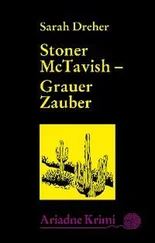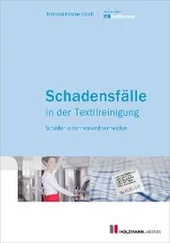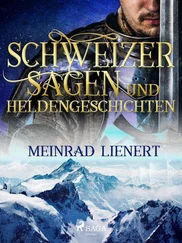[1]
Vgl. schon die Nachweise bei Rittner , in: FS Bartholomeyczik, 1973, S. 319, 320 Fn. 5.
[2]
Vgl. etwa Ekey , Grundriss des Wettbewerbs- und Kartellrechts, 5. Aufl. 2016; Haberstumpf/Husemann , Wettbewerbs- und Kartellrecht, Gewerblicher Rechtsschutz, 6. Aufl. 2015; ferner Hönn/Karb , Klausurenkurs im Wettbewerbs- und Kartellrecht, 7. Aufl. 2019; ders. , Wettbewerbs- und Kartellrecht (Examens-Repetitorium), 3. Aufl. 2015; Schwintowski , Wettbewerbs- und Kartellrecht (Prüfe dein Wissen), 5. Aufl. 2012; Sosnitza , Fälle zum Wettbewerbs- und Kartellrecht, 6. Aufl. 2011.
[3]
Vgl. etwa I. Schmidt/Haucap , Wettbewerbspolitik und Kartellrecht, 10. Aufl. 2013; Bester , Theorie der Industrieökonomik, 7. Aufl. 2017; Bishop/Walker , The Economics of EC Competition Law, 4. Aufl. 2017; Richter/Furubotn , Neue Institutionenökonomik, 4. Aufl. 2010; Knieps , Wettbewerbsökonomie, 3. Aufl. 2008.
[4]
Vgl. Rdnr. 100, 770.
[5]
Vgl. dazu Rittner , AcP 188 (1988), 318.
[6]
Vgl. v. Hayek , Recht, Gesetzgebung und Freiheit, Bd. 3, 1981, S. 97 ff.
[7]
Dies schließt es freilich nicht aus, in einer negativen Abgrenzung konkrete – unlautere oder wettbewerbsbeschränkende – Handlungen zu benennen, die im Wettbewerb verboten sein sollen.
[8]
Vgl. Rittner , in: FS Kraft, 1998, S. 519, 522 ff.
[9]
Lobe , SächsArchiv 5 (1895), 59, 63 f; vgl. des näheren Rittner , in: FS Kraft, 1998, S. 519, 521 Fn. 13.
[10]
Vgl. schon Schmidt-Rimpler , AcP 147 (1941), 130, bes. S. 165, 169 zur „bangen Wahl zwischen hoheitlicher Gestaltung und Vertrag“.
[11]
Vgl. nur Rittner , JZ 1995, 849 m. w. Nachw.
[12]
Vgl. dazu z. B. Di Fabio , Wettbewerbsprinzip und Verfassung, ZWeR 2007, 266 ff; von Danwitz , Grundrechtsschutz im dezentralen Vollzug europäischen Kartellrechts, in: FS Scholz, 2008, S. 1019 ff; Hellermann , Grundrechtliche Wettbewerbsfreiheit, in: FS Wahl, 2011, S. 323 ff; van Vormizeele , Kartellrecht und Verfassungsrecht, NZKart 2013, 386 ff.
[13]
Vgl. Rittner , in: FS Müller-Freienfels, 1986, S. 491, 509; Ruffert , Vorrang der Verfassung und Eigenständigkeit des Privatrechts, 2001, S. 287 ff; Rittner/Dreher , Europäisches und deutsches Wirtschaftsrecht, 3. Auflage 2008, § 1 Rdnr. 48 und § 4 Rdnr. 23 ff; Dreher , JZ 2014, 185 ff.
[14]
Vgl. etwa zum grundrechtlichen Kontext Isensee , in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HdStR Bd. IX, 3. Aufl. 2011, § 190 Rdnr. 182, 291 ff, 305 ff.
2. Das Wettbewerbs- und Kartellrecht innerhalb der Gesamtrechtsordnung
9
a) Im Kontext der Gesamtrechtsordnung, von dem aus der Jurist jede einzelne Norm und jedes Rechtsgebiet verstehen muss, findet das „Wettbewerbs- und Kartellrecht“ schon deswegen nicht leicht seinen rechten Ort, weil die beiden Teilgebiete, wie gezeigt, in mancher Hinsicht heterogen sind.[1] Die traditionelle dichotome Systematisierung des gesamten Rechts, die den Rechtsstoff in das Privatrecht einerseits und das öffentliche Recht andererseits teilt, scheint jene Zusammenfassung sogar zu verbieten, ja vielleicht nicht einmal die – vom Gesetzgeber doch vorgesehene – Einheit des Kartellrechts selbst zu dulden; gehört das Kartellrecht doch teils dem Privatrecht, teils dem (Wirtschafts-)Verwaltungsrecht und dem Ordnungswidrigkeitenrecht an.
10
Die zweidimensionale Systematik, die jener Dichotomie bewusst oder unbewusst zugrunde liegt, entspricht jedoch, wenn sie überhaupt je richtig war, nicht mehr dem geltenden Recht.[2] Die moderne Rechtsordnung wird nämlich von mehr als den zwei fundamentalen Gedanken getragen, nach denen der gesamte Rechtsstoff – wie im 19. Jahrhundert – in die beiden großen, voneinander getrennt gesehenen „Gebiete“, das Privatrecht und das öffentliche Recht, aufgeteilt wurde. Einer dieser „modernen“ Grundgedanken ist der des Wirtschaftsrechts, wie ihn schon Art. 151 WRV formuliert hat.[3] Danach hat der Staat für eine „Ordnung des Wirtschaftslebens“ zu sorgen, die den „Grundsätzen der Gerechtigkeit“ entspricht und die „Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle“ zum Ziele hat. Noch umfassender wird dieser Auftrag durch das Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes und die europäischen Verträge ausgestaltet und, namentlich durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs, konkretisiert.
11
Daraus und aus dem Kontext der Verfassung ergeben sich die Grundgedanken des Wirtschaftsrechts: Einerseits wird es bestimmt durch den Vorrangund die Gewährleistung privatautonomer Gestaltungauf der Grundlage der Eigentums- und Vertragsfreiheit. Andererseits wird es in vielfältiger Weise durch hoheitliche Elemente mitgestaltet, die nicht nur die individualrechtliche Richtigkeit, sondern auch die gesamtwirtschaftliche Gerechtigkeitdes wirtschaftlichen Handelns sichern sollen. Der Einsatz hoheitlicher Elemente wie gesetzlicher Verbote, behördlicher Aufsicht oder gerichtlicher Kontrollen verlangt freilich vom Gesetzgeber eine – den Verhältnissen einer höchst komplizierten Sozial- und Rechtsordnung entsprechende – außerordentliche Sorgfalt, sollen die vom Grundgesetz gesteckten Ziele erreicht werden. Erst wenn dem Gesetzgeber dies gelingt, kommt es zu dem sinnvollen Zusammenspiel privatautonomer und hoheitlicher Elemente, das ein modernes Wirtschaftsrecht charakterisiert.
12
b) Das Kartellrechtgehört zu den wichtigsten Teilen des – für alle Branchen einheitlichen –[4] Allgemeinen Wirtschaftsrechts. Für die Wirtschafts ordnung der Marktwirtschaft ist der Wettbewerb der zentrale Koordinierungsmechanismus, das Kartellrecht daher für das Wirtschafts recht der Marktwirtschaft die zentrale Rechtsmaterie. Zwar setzt der wirtschaftliche Wettbewerb die Rechtsinstitute des Privatrechts voraus, insbesondere das Unternehmensrecht, das Recht der Güterzuordnung (Sachenrecht, geistiges Eigentum), das Vertragsrecht. Zudem unterliegt er den Einflüssen des überwiegend öffentlich-rechtlichen allgemeinen Lenkungsrechts durch Globalsteuerung (z. B. Geld- und Kreditpolitik) oder Einzelsteuerung (z. B. Subventionen). Doch ist das primär gegen privatautonome Beschränkungen des Wettbewerbs gerichtete Kartellrecht für das Wirtschaftsrecht der Marktwirtschaft konstitutiv.
13
Die Vergabe öffentlicher Aufträgesteht seit jeher unter dem Wettbewerbsprinzip, das den Vergabeverfahren zugrunde liegt.[5] Die EU-rechtlichen Vorgaben für diese Verfahren, die Aufträge bestimmter Größenordnungen betreffen, setzt der deutsche Gesetzgeber seit dem Jahr 1998 im Vierten Teil (§§ 97 ff) des GWB um und hat die Vergabe öffentlicher Aufträge damit aus dem Haushaltsrecht gelöst. Inzwischen hat das Kartellrecht die Praxis des Vergaberechts nicht unerheblich beeinflusst.[6] Der – sachlich ursprünglich durchaus naheliegende – Gedanke, ein eigenes und umfassendes Vergabegesetz zu erlassen, das dann den Vierten Teil des GWB ersetzen würde, ist unter anderem aufgrund der Durchsetzung des Wettbewerbsgedankens im Kartellvergaberecht mittlerweile nicht mehr zu verfolgen.[7] Da das Kartellvergaberecht mit den Sonderregeln für bestimmte Auftraggeber systematisch zu dem Besonderen Wirtschaftsrecht gehört, wird es im vorliegenden Zusammenhang nicht dargestellt.
14
Das Unlauterkeitsrechtwird im Allgemeinen nicht zum Wirtschaftsrecht gezählt. Teilt es doch mit den Rechtsmaterien des Privatrechts den individualschützenden Charakter und – jedenfalls bis in die jüngere Vergangenheit – den Verzicht auf administrative Befugnisse. Von den Rechtsmaterien des Privatrechts, die rechtsinstitutionelle Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Wettbewerb schaffen, ohne sich auf diesen zu beschränken, unterscheidet es sich freilich dadurch, dass es ausdrücklich nur für die in § 2 UWG legaldefinierten „geschäftlichen Handlungen“ konzipiert ist. Zudem schützt es – insofern mit dem Kartellrecht übereinstimmend – auch „das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb“ (§ 1 UWG). Zwar ist die einschlägige Fallgruppe („allgemeine Marktbehinderung“ oder „Marktstörung“) klein, sind die Anwendungsfälle selten. Doch ist „das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb“ ein typisch wirtschaftsrechtlicher Wertungsgedanke, der auch das Unlauterkeitsrecht in den Kontext gesamtwirtschaftlicher Richtigkeit einbindet.
Читать дальше