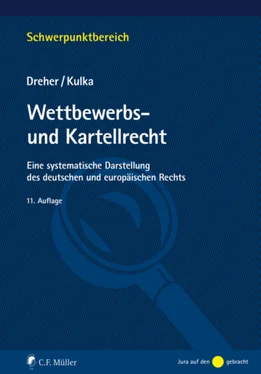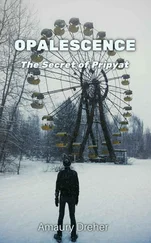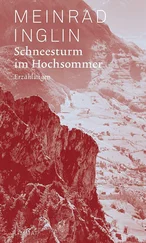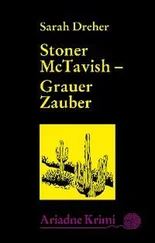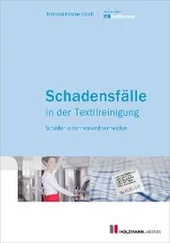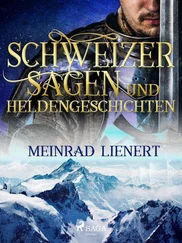I. Die Rechtsgrundlagen und die Regelungstechnik
II.Die GVO 330/2010 für vertikale Wettbewerbsbeschränkungen
1. Allgemeines
2. Die freigestellten Vereinbarungen
3. Die Marktanteilsschwellen
4. Die Kataloge verbotener Klauseln
a) Die Kernbeschränkungen (Liste schwarzer Klauseln) nach Art. 4 GVO 330/2010
b) Die Liste grauer Klauseln nach Art. 5 GVO 330/2010
5. Der Entzug der Freistellung
6. Die Erklärung der Unanwendbarkeit der Vertikal-GVO
III.Die Kfz-GVO Nr. 461/2010
1. Allgemeines
2. Die freigestellten Vereinbarungen
3. Die Marktanteilsschwellen
4. Die Kataloge verbotener Klauseln
5. Die Erklärung der Unanwendbarkeit der Kfz-GVO
D.Die kartellverbotsfreien vertikalen Vereinbarungen
I. Die Bekanntmachungen der Kommission
II.Die Einzelverträge und die Vertriebssysteme
1. Die Rechtsnatur der Vertikalvereinbarungen
2. Die Einzelverträge
3. Die Vertriebssysteme
III.Einzelfälle
1. Die qualitative und die quantitative Selektion
2. Der Handelsvertretervertrag
3. Die Bezugs- oder Lieferverträge
4. Die Franchiseverträge
5. Das Konzept des wirtschaftlichen Nachfragers
E. Anhang zu § 9: Preisbindung, Preisempfehlung und Meistbegünstigung im Vertikalverhältnis
§ 10 Das Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung nach Art. 102 AEUV
A.Grundlagen
I. Das Missbrauchsverbot und seine Grenzen
II. Die Entstehungsgeschichte und der Wortlaut des Missbrauchsverbots
III.Das geltende Recht
1. Das europäische Recht
2. Das deutsche Recht
B.Der Tatbestand des Art. 102 AEUV und seine Anwendung
I. Die Normstruktur und die Stellung von Art. 102 AEUV im europäischen Kartellrecht
II.Die marktbeherrschende Stellung
1. Der zweistufige Ansatz
2. Der relevante Markt
3. Die beherrschende Stellung
III.Der Missbrauch
1. Der Missbrauchsbegriff
2.Die Fallgruppen
a) Grundlagen
b) Der Preis- und der Konditionenmissbrauch
c) Der Verdrängungsmissbrauch durch Kampfpreise
d) Die Ausschließlichkeitsbindungen
e) Die Koppelungsverträge
f) Die Rabattsysteme
g) Die Lieferverweigerung und der Abbruch von Geschäftsbeziehungen
h) Die Essential Facilities-Fälle
i) Die Diskriminierung von Handelspartnern
j) Die sonstigen Missbrauchsfälle
3. Die objektive Rechtfertigung
IV. Die Rechtsfolgen von Verstößen
§ 11 Die Verbote des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung und sonstiges wettbewerbsbeschränkendes Verhalten nach dem GWB
A. Grundlagen
B.Die Definitionsnormen und Vermutungen (§ 18 GWB)
I. Überblick
II.Das Monopol und die überragende Marktstellung
1.Das Monopol und das Quasi-Monopol
a) Der relevante Markt
b) Das Monopol
c) Das Quasi-Monopol
2. Die überragende Marktstellung
III. Die Oligopolfälle
IV.Die Vermutungen
1.Allgemeines
a) Die Entwicklung
b) Die rechtliche Funktion der Vermutungen
c) Die Anwendung der Vermutungen
2. Die Vermutung der Einzelmarktbeherrschung
3. Die Oligopolvermutung
4. Das Verhältnis der Vermutungen zueinander
C.Das Behinderungs- und Diskriminierungsverbot (§ 19 Abs. 2 Nr. 1 GWB)
I. Rechtspolitische Vorfragen und die Lösung des GWB
II.Die Normadressaten
1. Die Einteilung
2. Das marktbeherrschende Unternehmen
3.Die Unternehmen mit „relativer Marktstärke“ (§ 20 Abs. 1 GWB)
a) Die relative Abhängigkeit
b) Die sortimentsbedingte Abhängigkeit
c) Die unternehmensbedingte Abhängigkeit
d) Die mangelbedingte Abhängigkeit
e) Die nachfragebedingte Abhängigkeit
f) Die datenbedingte Abhängigkeit
4. Die Beweislast und die Vermutung der Abhängigkeit
III.Die Verbotstatbestände
1. Die unbillige Behinderung (§ 19 Abs. 2 Nr. 1 1. Fall)
2. Die ungerechtfertigte Diskriminierung (§ 19 Abs. 2 Nr. 1 2. Fall)
3. Die sogenannte passive Diskriminierung (§ 19 Abs. 2 Nr. 5)
IV.Die Rechtsfolgen
1.Das zivilrechtliche Verfahren
a) Der Anspruch auf Belieferung
b) Der Anspruch auf eine Zwangslizenz
aa) Schutzrecht ohne Standardisierungsfunktion
bb) Schutzrecht als Teil eines Industriestandards
cc) Schutzrecht als De-facto-Standard
c) Der Duldungsanspruch wegen Rechtsmissbrauchs
d) Der Anspruch auf Schadenersatz
e) Die Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts
2. Das kartellbehördliche Verfahren
D.Die weiteren Missbrauchsverbote für Marktbeherrscher (§ 19 Abs. 1 und 2 Nr. 2 bis 4 GWB)
I.Allgemeines
1. Die Generalklausel
2. Die Regelbeispiele des Absatzes 2
a) Der Ausbeutungsmissbrauch
aa) Die Problematik
bb) Der Maßstab
cc) Das Vergleichsmarktkonzept
dd) Das Konzept der Gewinnbegrenzung
ee) Die Rechtfertigung
b) Der Konditionenmissbrauch
c) Die Preis- und Konditionenspaltung
d) Die Liefer- und Zugangsverweigerung
3. Die Rechtsfolgen
E. Die Missbrauchsverbote für Unternehmen mit überragender marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb (§ 19a GWB)
F.Die sogenannte Mittelstandsbehinderung (§ 20 Abs. 3 und 4 GWB)
I. Die Voraussetzungen
II. Die Rechtsfolgen
III. Die Praxis
G.Sonstige Verhaltensverbote
I. Allgemeines
II. Die missbräuchliche Förderung von Tipping (§ 20 Abs. 3a GWB)
III.Das Boykottverbot (§ 21 Abs. 1 GWB)
1. Die Voraussetzungen
2. Die Rechtsfolgen eines Verstoßes
IV. Die unerlaubte Veranlassung (§ 21 Abs. 2 GWB)
V. Der unerlaubte Zwang (§ 21 Abs. 3 GWB)
VI. Die unerlaubte Nachteilszufügung (§ 21 Abs. 4 GWB)
VII.Die Ablehnung der Aufnahme in eine Vereinigung (§ 20 Abs. 5 GWB)
1. Das rechtspolitische Problem
2. Die Regelung
H.Die sektorspezifische Missbrauchsaufsicht
I. Die Energiewirtschaft
II. Die Wasserwirtschaft
III. Die Überprüfung öffentlich-rechtlicher Gebühren und Beiträge
§ 12 Die Wettbewerbsregeln von Verbänden nach dem GWB
A.Grundlagen
I. Der Begriff
II.Die Funktion
1. Die gesetzliche Differenzierung
2. Die Grundsätze des lauteren Wettbewerbs
3. Die Wirksamkeit eines leistungsgerechten Wettbewerbs
B.Die Aufstellung und die Anerkennung
I. Die Aufstellung und die verpflichtende Wirkung
II.Die Anerkennung
1. Das Prüfungsverfahren und die Publizität
2. Die Änderungen und die Aufhebung
C. Die Praxis und Reformfragen
D. Das europäische Kartellrecht
§ 13 Die öffentlichen und monopolartigen Unternehmen nach Art. 106 AEUV
A.Grundlagen
I. Das Problem
II. Die öffentlichen Unternehmen im deutschen Kartellrecht
III. Die ergänzenden Regelungen des AEUV
B.Die Unternehmen nach Art. 106 Abs. 1 AEUV
I.Die Normadressaten
1. Die öffentlichen Unternehmen
2. Die Unternehmen mit besonderen oder ausschließlichen Rechten
II. Die Rechtsfolgen
C.Die Unternehmen nach Art. 106 Abs. 2 AEUV
I.Die Normadressaten
1. Die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse
2. Die Finanzmonopole
II.Die Rechtsfolgen
1. Die Geltung der Vertragsbestimmungen und die Ausnahme
2. Die Gegenausnahme
D. Die Kompetenzen der Kommission nach Art. 106 Abs. 3 AEUV
§ 14 Die Zusammenschlusskontrolle
A.Grundlagen
I.Das Problem der Unternehmenskonzentration
1. Der Begriff der Konzentration
2. Unternehmensgröße oder Marktstellung?
3. Die Entflechtung von Unternehmen
II.Das europäische Kartellrecht
1. Die Fusionskontrollverordnung
2. Die präventive Zusammenschlusskontrolle
3. Das Verhältnis zum nationalen Recht
Читать дальше