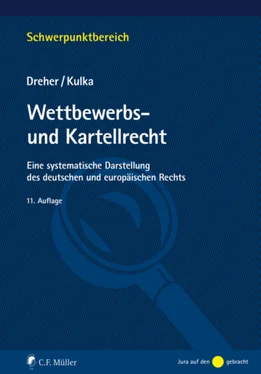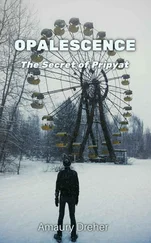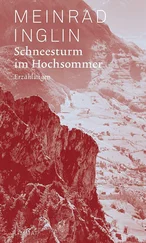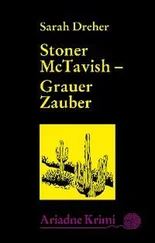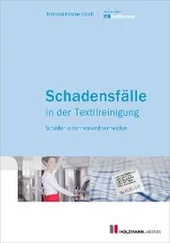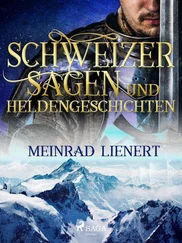1. Das Problem
2. Das besatzungsrechtliche Kartellrecht und die Vorarbeiten zu einem deutschen Kartellgesetz
3. Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen von 1957 und seine Novellen
4. Das europäische Kartellrecht
B.Die rechtspolitischen und -systematischen Grundlagen
I. Die rechtspolitischen Kompetenzmodelle
II.Die rechtspolitische Konzeption des GWB und ihre Wandlungen
1. Die ökonomischen Konzepte: vom Ordo-Liberalismus über Harvard- und Chicago School zur wettbewerbsökonomischen Kakophonie
2. Der Wettbewerb als rechtliches Ordnungsprinzip
III.Die Konzeption des EU-Kartellrechts
1. Der EWG-Vertrag und die VO 17 als Ausgangspunkte
2. Die Politik der Kommission und die Rechtsprechung des EuGH
3. Die VO 1/2003
4. Der „more economic approach“ der Kommission
5. Der Vertrag von Lissabon
IV.Die Wettbewerbsökonomie
1. Von der Wettbewerbstheorie zur Wettbewerbsökonomie
2.Die Rolle der Wettbewerbsökonomie im Kartellrecht
a) Die Tatbestandsauslegung
b) Die Marktabgrenzung
c) Die Zusammenschlusskontrolle
d) Die Schadenberechnung
3. Die Nachweis- und Prüfungsstandards für wettbewerbsökonomische Thesen im Recht
V.Die Systematik der Wettbewerbsbeschränkungen
1. Die rechtspolitische Aufgabe
2. Die Systematik des GWB
3. Die Systematik des europäischen Kartellrechts
C.Die Rechtsanwendung im Kartellrecht
I.Grundlagen
1. Die Verfahrensarten
2. Die Funktion und der Inhalt der Tatbestände
3. Die Ermessensfrage
II.Die Auslegung von kartellrechtlichen Tatbeständen
1. Die Auslegung des GWB
2. Die Auslegung des europäischen Kartellrechts
§ 6 Grundbegriffe und Anwendungsbereiche
A.Grundbegriffe
I. Das Problem
II.Die Unternehmen und die Vereinigungen von Unternehmen
1. Der Unternehmensbegriff des Kartellrechts
a) Die allgemeine Begriffsbestimmung
b) Die Unterscheidung von absoluten und relativen Unternehmen
2. Die Freien Berufe als Unternehmen
3. Die juristischen Personen des öffentlichen Rechts als Unternehmen
4.Die verbundenen und weisungsabhängigen Unternehmen
a) Die Verbundklausel des deutschen Kartellrechts
b) Die wirtschaftliche Einheit bei Absatzmittlern
c) Die wirtschaftliche Einheit bei verbundenen Unternehmen
5. Die Vereinigungen von Unternehmen
6. Die kleinen und mittleren Unternehmen
III.Wettbewerb, Wettbewerbsbeschränkung, Markt
1. Der Wettbewerb
2. Die Wettbewerbsbeschränkung
3.Der Markt und der relevante Markt
a) Allgemeines
b) Die Abgrenzung des relevanten Markts im Einzelfall
c) Die Unbeachtlichkeit potentiellen Wettbewerbs bei der Marktabgrenzung
IV. Sonstige Grundbegriffe
B.Die Sonderregelungen für bestimmte Wirtschaftsbereiche
I. Das Phänomen und seine Gründe
II.Der gegenwärtige Stand
1. Das europäische Kartellrecht
2. Das GWB
C.Der räumliche Anwendungsbereich und das Verhältnis von nationalem und europäischem Kartellrecht
I.Die allgemeinen Regelungen
1. Das Auswirkungsprinzip
2. Das internationale Kartellprivatrecht
II.Das Verhältnis von GWB und europäischem Kartellrecht
1. Der AEUV
2. Die Verordnung Nr. 1/2003
3. Die Zusammenschlusskontrolle
D.Die internationalen Wettbewerbsbeschränkungen
I. Die Problematik und die Lösungsversuche
II. Der EWR
III. Die internationale Kooperation der Wettbewerbsbehörden
E. Übersicht: Verhältnis GWB – EU-Recht
§ 7 Die beiden Kartellverbote
A.Der Kartellbegriff und der Kartellverbotstatbestand
I.Art. 101 Abs. 1 AEUV und § 1 GWB im Vergleich
1. Der Normgehalt
2. Die historische Entwicklung des Kartellbegriffs
3. Die Kartellbegriffe
II.Der Kartelltatbestand als rechtspolitische Aufgabe
1. Die historische Entwicklung
2. Die Kartelltatbestände des geltenden Rechts
III. Folgerungen
B.Das Kartellverbot des Art. 101 Abs. 1 AEUV
I. Der Tatbestand im Überblick
II. Die Zwischenstaatlichkeitsklausel
III.Die drei erfassten Handlungen
1. Grundlagen
2. Die Vereinbarungen
3. Die Beschlüsse
4. Die aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen
IV.Die Wettbewerbsbeschränkung
1. Grundlagen
2. Der Wettbewerbsbegriff
3. Die Wettbewerbsbeschränkung
4. Das Tatbestandsmerkmal „bezwecken oder bewirken“
5. Der Regelbeispielskatalog des Art. 101 Abs. 1 AEUV
6. Die Spürbarkeit der Wettbewerbsbeschränkung
V.Die Abgrenzung gegenüber kartellfreien Handlungen
1. Das Problem und seine Lösung
2. Die Nebenabreden, insbesondere Wettbewerbsverbote, in Gesellschaftsverträgen
3. Die Nebenabreden in Interessenwahrungsverträgen
4. Die Nebenabreden in Bezugs- und Lieferverträgen
5. Die Nebenabreden in Verträgen über Unternehmen und Beteiligungen
VI.Die Ausnahmen vom Kartellverbot
1. Grundlagen
2.Die Anwendung des Kartellverbotstatbestands als Einheit
a) Grundlagen und Beweislastregelung
b) Die Rechtsanwendung durch die deutschen Kartellbehörden und Gerichte
c) Die Rechtsanwendung durch die Kommission
3. Die Gruppenfreistellungsverordnungen
4. Art. 101 AEUV in der Fallbearbeitung zu Ausbildungszwecken
C.Das Kartellverbot des § 1 GWB
I. Die Auslegung und Anwendung der Norm
II. Die drei erfassten Handlungen
III. Die Wettbewerbsbeschränkung
IV. Die Abgrenzung gegenüber den kartellfreien Handlungen
V. Die Ausnahmen vom Kartellverbot
D.Die Rechtsfolgen von Verstößen gegen die Kartellverbote
I. Die Rechtsfolgen im Überblick
II. Die Nichtigkeit von Vereinbarungen
E. Anhang zu § 7: Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen (Normen, Texte)
§ 8 Die Ausnahmen von den Kartellverboten für horizontale Wettbewerbsbeschränkungen
A. Die Unterscheidung von horizontalen und vertikalen Wettbewerbsbeschränkungen
B.Die unmittelbare Anwendung des Art. 101 Abs. 3 AEUV
I. Überblick
II.Die „Ziele“ der Wettbewerbsbeschränkung
1. Allgemeines
2. Die konkreten Ziele
III. Die Unerlässlichkeit der Wettbewerbsbeschränkung
IV. Die angemessene Beteiligung der Verbraucher
V. Die Erhaltung des Restwettbewerbs
C.Die Ausnahmen nach den Gruppenfreistellungsverordnungen im Horizontalverhältnis
I.Überblick
1. Die Rechtsgrundlagen
2. Die Gruppenfreistellungsverordnungen
3. Die Regelungstechnik der GVO
II.Die GVO Nr. 1218/2010 für Spezialisierungsvereinbarungen
1. Allgemeines
2. Die freigestellten Vereinbarungen
3. Die Marktanteilsschwelle
4. Die Kernbeschränkungen
5. Der Entzug der Freistellung
III.Die GVO Nr. 1217/2010 für Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen
1. Allgemeines
2. Die freigestellten Vereinbarungen
3. Die besonderen Freistellungsvoraussetzungen
4. Die Marktanteilsschwelle und die Freistellungsdauer
5. Die Kernbeschränkungen
6. Der Entzug der Freistellung
D.Die Mittelstandskartelle des § 3 GWB
I. Allgemeines
II.Die materiellen Freistellungsvoraussetzungen
1. Die Rationalisierung wirtschaftlicher Vorgänge
2. Die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU
3. Das Fehlen einer wesentlichen Wettbewerbsbeeinträchtigung
E. Die kartellverbotsfreie Zusammenarbeit nach den Bekanntmachungen der Kommission
§ 9 Die Ausnahmen von den Kartellverboten für vertikale Wettbewerbsbeschränkungen
A. Die kartellrechtliche und wettbewerbsökonomische Erfassung von vertikalen Vereinbarungen
B. Die unmittelbare Anwendung des Art. 101 Abs. 3 AEUV
C.Die Ausnahmen nach den Gruppenfreistellungsverordnungen im Vertikalverhältnis
Читать дальше