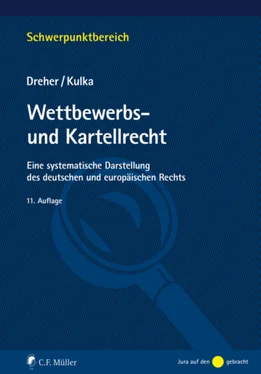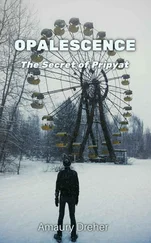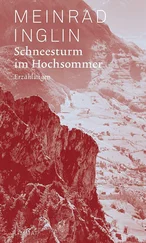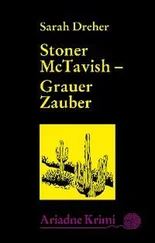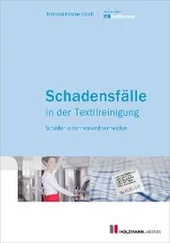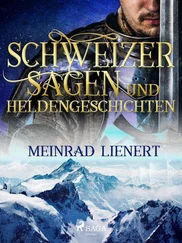[8]
Eine Bestandsaufnahme von 2010 bei Henning-Bodewig , GRUR Int 2010, 273.
Einleitung Rechtssystematische und rechtspolitische Grundlagen› III. Das Wettbewerbs- und Kartellrecht als Studien- und Prüfungsfach
III. Das Wettbewerbs- und Kartellrecht als Studien- und Prüfungsfach
44
Seit Jahrzehnten kennen die Prüfungsordnungen das „Wettbewerbs- und Kartellrecht“ als eigenes Fach, sei es im Referendar-, sei es im Assessorexamen. Die Zusammenfassunghat sich im Großen und Ganzen bewährt. Der Lehre hat das Fach freilich manche Probleme gestellt. Denn es verbindet drei Rechtsgebiete, die unterschiedliche Wurzeln haben: das Unlauterkeitsrecht mit seinen engen Verbindungen zum Gewerblichen Rechtsschutz und zum zivilrechtlichen Deliktsrecht; das deutsche Kartellrecht, das aus dem Kontext des gesamten Wirtschaftsrechts zu verstehen ist und vor allem starke Bezüge zum Wirtschaftsverwaltungs- und Ordnungswidrigkeitenrecht aufweist; und schließlich das gegenüber dem nationalen Kartellrecht dominante EU-Kartellrecht, das seinerseits zum europäischen Wirtschaftsrecht gehört.
45
Unterricht und Prüfung im Wettbewerbs- und Kartellrecht sind ohne das EU-Rechtheute nicht mehr möglich. Im Wettbewerbsrechtsind europarechtliche Grundkenntnisse sowie die Fähigkeit zu einer EU-konformen Anwendung des deutschen Rechts erforderlich. Dieses Lehrbuch gibt dazu die notwendigen Hilfestellungen. Im Kartellrechthat das EU-Recht das nationale Recht an vielen Stellen bereits verdrängt. Das Lehrbuch stellt daher überall das EU-Recht voran, weil es nach der VO Nr. 1/2003 jedenfalls grundsätzlich den Vorrang genießt.
46
In den Prüfungen– dies gilt für Klausuren ebenso wie für mündliche Prüfungen – bestehen im Wettbewerbs- und Kartellrecht einige spezifische Schwierigkeiten. Im Wettbewerbsrecht ist – trotz immer umfangreicherer gesetzlicher Regelungen – zwar in der Praxis die höchstrichterliche Rechtsprechung von erheblicher Bedeutung, doch können Detailkenntnisse angesichts des Umfangs dieser Rechtsprechung von (durchschnittlichen) Kandidaten kaum verlangt werden. Im Kartellrecht sind die Sachverhalte typischerweise komplex und verlangen eine schwierige wirtschaftliche Einschätzung. Zudem sind die einschlägigen Rechtstexte, insbesondere die EU-Verordnungen – sofern sie überhaupt Prüfungsgegenstände sind – umfangreich. Praktisch spielen darüber hinaus die Bekanntmachungen der Kartellbehörden eine große Rolle. Sie stehen in Prüfungen in der Regel nicht zur Verfügung, und Detailkenntnisse wird man auch in dieser Hinsicht kaum verlangen dürfen. Maßgeblich für die Beurteilung einer Prüfungsleistung im Wettbewerbs- und Kartellrecht sollte daher vor allem das Vorhandensein von solidem Grundlagenwissen, der sachgerechte Umgang mit den zur Verfügung stehenden Gesetzestexten und ein gutes Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge sein.
1. Teil Das Recht gegen unlauteren Wettbewerb
1. Teil Das Recht gegen unlauteren Wettbewerb
Inhaltsverzeichnis
§ 1 Grundlagen
§ 2 Die Generalklausel des § 3 UWG
§ 3 Fallgruppen der Unlauterkeit
§ 4 Die Durchsetzung des Wettbewerbsrechts
1. Teil Das Recht gegen unlauteren Wettbewerb› § 1 Grundlagen
Inhaltsverzeichnis
A. Begriff und Entwicklung des Wettbewerbsrechts
B. Die Schutzzwecke des Wettbewerbsrechts
C. Die systematische Stellung des Wettbewerbsrechts
D. Die gesetzlich definierten Personengruppen
E. Konkurrenzen und internationalrechtliche Fragen
F. Anhang zu § 1 (Legaldefinitionen)
A. Begriff und Entwicklung des Wettbewerbsrechts
47
Das Recht gegen unlauteren Wettbewerb[1] wird seit langem als Wettbewerbsrecht– zur Abgrenzung vom Kartellrecht oft mit dem Zusatz „im engeren Sinn“[2] – bezeichnet. Es umfasst die Rechtsnormen, die sich gegen unlauteres Verhalten im wirtschaftlichen Wettbewerb richten. Allerdings haben einige Entwicklungen in jüngerer Zeit den Wettbewerb als Schutzgegenstand des Wettbewerbsrechts in den Hintergrund treten lassen. So hat der Gesetzgeber 2004 bei der umfassenden Modernisierung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) zum Ausdruck gebracht, dass das Gesetz auch Handlungen von Monopolisten, die per definitionem keinem Wettbewerb ausgesetzt sind, erfassen soll.[3] Außerdem verbietet das UWG seit der Novelle 2008 auch unlautere geschäftliche Handlungen nach (!) Vertragsschluss (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG (Nr. 2 RegE) ),[4] die für den Wettbewerb um den Kunden meistens nicht oder nur mittelbar von Bedeutung sind. Darüber hinaus hat der Gesetzgeber bei der UWG-Novelle 2008 den Rechtsbegriff „Wettbewerb“ an einigen wichtigen Stellen im Gesetz durch neue Formulierungen ersetzt.[5] Verwendet wird der Begriff jedoch weiterhin im Titel des Gesetzes und in den zentralen Vorschriften § 1 S. 2 (Abs. 1 S. 2 RegE) und § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG (Nr. 4 RegE) . Insofern besteht keine Notwendigkeit, den eingeführten Begriff „Wettbewerbsrecht“ als Kurzbezeichnung für das Recht gegen unlauteren Wettbewerb aufzugeben.
48
Zur besseren Abgrenzung vom Kartellrecht, das oft auch seinerseits, vor allem im EU-Recht, als „Wettbewerbsrecht“ bezeichnet wird,[6] wird das Wettbewerbsrecht im engeren Sinn allerdings häufig als „Lauterkeitsrecht“oder „Unlauterkeitsrecht“bezeichnet.[7] Damit ist jedoch kein weiterer Gewinn verbunden; denn auch diese Begriffe erweisen sich als unpräzise: Zum einen wird das Tatbestandsmerkmal „unlauter“ nicht nur im Wettbewerbsrecht, sondern auch in anderen Rechtsgebieten verwendet (vgl. etwa § 14 Abs. 2 Nr. 3 und § 15 Abs. 3 MarkenG). Zum anderen verbietet das UWG seit der Novelle 2008 auch geschäftliche Handlungen, die nicht „unlauter“, sondern „unzulässig“ sind (vgl. § 3 Abs. 3 und § 7 Abs. 1 S. 1 UWG). Das schließt es zwar nicht aus, den Begriff „unlauterer Wettbewerb“ als pars pro toto für alle wettbewerbsrechtlich verbotenen (unlauteren oder unzulässigen) Handlungen zu verwenden, legt aber die Ersetzung des eingeführten Begriffs „Wettbewerbsrecht“ durch den Terminus „(Un-)Lauterkeitsrecht“ nicht gerade nahe.
49
Inhaltlich trägt der unbestimmte Rechtsbegriff „unlauter“ohnehin wenig zu einer trennscharfen Abgrenzung des Wettbewerbsrechts als Rechtsgebiet bei. Im außerrechtlichen Sprachgebrauch beziehen sich die Attribute „lauter“ bzw. „unlauter“ als Wörter einer gehobenen Sprache eher auf Menschen und Gesinnungen als auf Handlungen und stehen für Eigenschaften von Personen wie Aufrichtigkeit oder Ehrlichkeit bzw. ihr Gegenteil.[8] Bezogen auf den Wettbewerb wird das Wort „unlauter“ oft mit „nicht fair, nicht legitim“ übersetzt.[9] Für den juristischen Sprachgebrauch hat der Gesetzgeber des UWG 2004 in der Regierungsbegründung eine eigene Definition gegeben, die sich am EU-Recht und an Art. 10 bisAbs. 2 PVÜ orientieren sollte. „Unlauter“ sind danach „alle Handlungen, die den anständigen Gepflogenheiten in Handel, Gewerbe, Handwerk oder selbstständiger beruflicher Tätigkeit zuwiderlaufen“.[10] Damit wird jedoch nur ein unbestimmter Rechtsbegriff („unlauter“) durch einen anderen unbestimmten Rechtsbegriff („unanständig“) ersetzt.
50
Klarer werden die Konturen des Wettbewerbsrechts als Rechtsgebiet erst bei einem Blick auf Schutzzweck und systematische Stellung seiner Regelungen (unten Rdnr. 85 ff), so dass an dieser Stelle nur eine vorläufige Abgrenzungvorgenommen werden kann. Die Normen des Wettbewerbsrechts schützen im Interesse eines unverfälschten wirtschaftlichen Wettbewerbs (§ 1 S. 2 UWG (Abs. 1 S. 2 RegE) ) Unternehmer und Verbraucher als Marktteilnehmer, d. h. als mit Absatz oder Bezug (Angebot oder Nachfrage) von Waren oder Dienstleistungen oder mit Abschluss oder Durchführung von Verträgen über Waren oder Dienstleistungen befasste Wirtschaftssubjekte (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 UWG (Nr. 3 RegE) ), gegen unanständige geschäftliche Handlungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG (Nr. 2 RegE) ). Sie richten sich gegen unlauteres wirtschaftliches Verhalten auf Märkten (vgl. § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG), die in aller Regel wettbewerblich organisiert sind, und betreffen die Art und Weise, das „Wie“, des wirtschaftlichen Wettbewerbs. Zum Wettbewerbsrecht in diesem Sinn zählen das UWG und das das UWG betreffende Unionsrecht. Vorschriften gegen unlautere geschäftliche Handlungen finden sich ferner im Strafgesetzbuch (StGB) bei den „Straftaten gegen den Wettbewerb“[11] und in Sondervorschriften. Sie können hier aus Raumgründen nur am Rande berücksichtigt werden.[12] Dagegen werden die marktverhaltensregelnden Normen, deren Verletzung den Tatbestand des Rechtsbruchs i. S. v. § 3a UWG erfüllt, nicht zum Wettbewerbsrecht gezählt, obwohl ihre Tatbestände und Schutzzwecke denjenigen des UWG nahestehen.[13]
Читать дальше