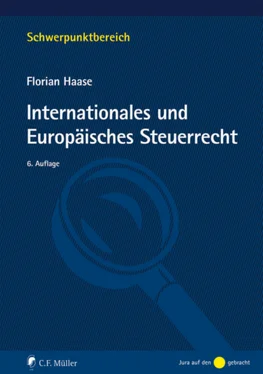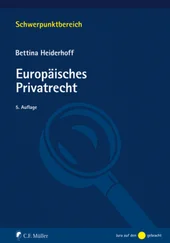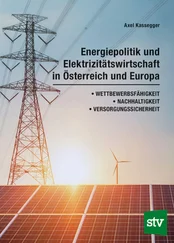Hier setzt das vorliegende Lehrbuch an. Erläutert werden die Grundprinzipien und Strukturen des deutschen Internationalen Steuerrechts sowie des Europäischen Steuerrechts. Dabei habe ich – unter bewusster Inkaufnahme von Vereinfachungen – besonderen Wert auf die Systematik und die Verständlichkeit gelegt, auch wenn dadurch der Detailreichtum gelitten haben mag. Viel wichtiger als Spezialwissen nämlich ist zunächst die sichere Beherrschung der großen Leitlinien. Alles Weitere muss einer späteren Spezialisierung vorbehalten bleiben, die auch in der Nische „Internationales Steuerrecht“ jedenfalls teilweise unerlässlich ist.
Das Buch wendet sich vornehmlich an Studierende der Rechtswissenschaften und deckt insoweit den Wahlpflichtbereich der Prüfungsordnungen ab. Es kann aber auch von Studierenden der betriebswirtschaftlichen Steuerlehre und von Praktikern mit Gewinn gelesen werden, die sich in das Internationale Steuerrecht einarbeiten möchten. Dies gilt insbesondere für jene Berufsanfänger, die die Steuerberaterprüfung anstreben. Über die Anmerkungen im Text zur Beratungspraxis und die in das Buch eingearbeiteten 50 Beispielsfälle wird auch insoweit bereits immer wieder ein praktischer Bezug hergestellt. Dargestellt werden – unter besonderer Berücksichtigung des Ertragsteuerrechts – die verschiedenen Arten persönlicher und sachlicher Steuerpflichten, die Konsequenzen der Begründung und Aufgabe steuerlicher Anknüpfungspunkte im Inland, das Außensteuerrecht nebst den Grundzügen von Verrechnungspreisen, das Recht der Doppelbesteuerungsabkommen sowie das Europäische Steuerrecht (hier liegt der Schwerpunkt auf den Grundfreiheiten und der Frage, wann eine nationale steuerliche Norm als gemeinschaftsrechtswidrig einzustufen ist).
Natürlich kommt man bei der Arbeit im Internationalen Steuerrecht ohne ein gewisses Vorwissen im nationalen Steuerrecht und im Europarecht nicht aus. Es wird daher vorausgesetzt, dass der in dieser Schwerpunkte-Reihe von Dieter Birk (Band 17/3: Steuerrecht) und Rudolf Streinz (Band 12: Europarecht) vermittelte Stoff jedenfalls im Grundsatz beherrscht wird. Auf diese und andere Bücher (ua der Schwerpunkte- Reihe) wird auch in den Fußnoten verwiesen, damit die Grundlagen ggf noch einmal nachgearbeitet werden können. Wer bereits als Studierender die Bereitschaft zeigt, sich mit der komplizierten Materie des Internationalen Steuerrechts auseinander zu setzen, wird nicht nur auf eine intellektuelle Herausforderung und die Arbeit in einem internationalen Umfeld mit Berührungen zu fremden Sprachen (die Arbeitssprache des Internationalen Steuerrechts ist Englisch), Rechtsordnungen und Kulturen hoffen dürfen, sondern langfristig vor Arbeitslosigkeit geschützt sein.
Am 12. März 2007 hat die Bundesregierung den Kabinettentwurf eines Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 veröffentlicht. In der Tat wird die seit langem erwartete Unternehmensteuerreform die Besteuerung von Personen- und Kapitalgesellschaften in einigen Bereichen grundlegend ändern. Man denke nur an die Abschaffung der kaum beherrschbaren Vorschrift der Gesellschafterfremdfinanzierung (§ 8a KStG). Das System des deutschen Internationalen Steuerrechts wird durch die Unternehmensteuerreform indes nicht angetastet. Insoweit mögen im Anhang zu diesem Buch einige Hinweise genügen, ohne dass die Aktualität leidet.
Anregungen, Fragen oder Kritik bitte ich zu richten an folgende mail-Adresse:
florianhaase@aol.com
Das Buch ist auf dem Rechtsstand von Mai 2007.
Hamburg, im Mai 2007
Florian Haase
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Aus dem Vorwort zur 1. Auflage
Abkürzungsverzeichnis
Verzeichnis der häufig zitierten Literatur
Nützliche Links zum Internationalen und Europäischen Steuerrecht im Internet
§ 1 Die internationale Dimension des Steuerrechts
A. Einführung
B. Grundlagen
I.Begriffsbestimmungen
1. Regelungsgegenstand des Internationalen Steuerrechts
2. Regelungsgegenstand des Europäischen Steuerrechts
3. Strukturprinzipien im Internationalen Steuerrecht
4.Doppelbesteuerung als Grundproblem
a) Ursachen
b) Erscheinungsformen
c) Maßnahmen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
II. Rechtsquellen
C. Begründung, Ausschluss und Beschränkung des Besteuerungsrechts
I. Allgemeiner Verstrickungs- und Entstrickungstatbestand
1. Verstrickung bei Begründung des Besteuerungsrechts
2. Entstrickung bei Ausschluss/Beschränkung des Besteuerungsrechts
II. Wegzugsbesteuerung bei natürlichen Personen (§ 6 AStG)
1. Tatbestand
2. Rechtsfolge
3. Künftige Neuregelung
III. Entstrickung und Schlussbesteuerung bei Körperschaften (§ 12 KStG)
IV. Verstrickung und Entstrickung bei Kapitalgesellschaftsanteilen (§ 17 EStG)
V. Exkurs: Entstrickung bei Umwandlungsvorgängen
D. Prüfungsreihenfolge bei internationalen Sachverhalten
§ 2 Die unbeschränkte Steuerpflicht im Ertragsteuerrecht
A. Persönliche Steuerpflicht
I.Einkommensteuer
1. Unbeschränkte Steuerpflicht (§ 1 Abs. 1 EStG)
a) Natürliche Personen
b) Inland
c) Wohnsitz (§ 8 AO)
d) Gewöhnlicher Aufenthalt (§ 9 AO)
2. Erweiterte unbeschränkte Steuerpflicht (§ 1 Abs. 2 EStG)
a) Deutsche Staatsangehörige
b) Angehörige (§ 15 AO)
c) Zusätzlich: beschränkte Steuerpflicht im Ansässigkeitsstaat
3. Unbeschränkte Steuerpflicht auf Antrag (§ 1 Abs. 3 EStG)
4. Ergänzungstatbestand für EU- und EWR-Familienangehörige
II.Körperschaftsteuer
1. Unbeschränkte Steuerpflicht (§ 1 Abs. 1 KStG)
a) Körperschaften/Personenvereinigungen/Vermögensmassen
b) Inland (§ 1 Abs. 3 KStG)
c) Geschäftsleitung (§ 10 AO)
d) Sitz (§ 11 AO)
2. Ausländische Rechtsgebilde
a) Gesellschaftsrechtliche Vorfragen
b) Einordnung in den Kanon des § 1 Abs. 1 KStG
III.Gewerbesteuer
1. Besondere Terminologie des Gewerbesteuerrechts
2. Gewerbetreibende als Steuersubjekte
B. Sachliche Steuerpflicht
I.Grundlegendes zum Besteuerungsumfang
1.Einkommensteuer
a) Unbeschränkte Steuerpflicht (§ 1 Abs. 1 EStG)
b) Erweiterte unbeschränkte Steuerpflicht (§ 1 Abs. 2 EStG)
c) Unbeschränkte Steuerpflicht auf Antrag (§ 1 Abs. 3 EStG)
2. Körperschaftsteuer
3.Gewerbesteuer
a) Beschränkung auf den stehenden inländischen Gewerbebetrieb
b) Zum Erfordernis einer inländischen Betriebsstätte
II.Die einzelnen Einkunftsarten bei der unbeschränkten Steuerpflicht
1.Einkommensteuer
a) Systematisierung der Einkünfte im Internationalen Steuerrecht
b) Ausländische Einkünfte (§ 34d EStG)
c) Besondere Besteuerungsregeln für im Ausland erzielte Einkünfte
2. Körperschaftsteuer
3.Gewerbesteuer
a) Vorbemerkungen
b) Hinzurechnungsvorschriften bei grenzüberschreitenden Sachverhalten
c) Kürzungsvorschriften bei grenzüberschreitenden Sachverhalten
III.Unilaterale Methoden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung bei der unbeschränkten Steuerpflicht
1. Vorbemerkungen
2.Einkommensteuer
a) Zentralnorm des § 34c EStG – Grundlegendes
b) Spezialnorm des § 32d Abs. 5 EStG – Grundlegendes
c) Spezialnorm des § 50d Abs. 10 Satz 5 EStG
d) Anrechnung ausländischer Steuern (§ 34c Abs. 1 EStG)
e) Alternativer Steuerabzug (§ 34c Abs. 2 EStG)
f) Obligatorischer Steuerabzug (§ 34c Abs. 3 EStG)
g) Steuerpauschalierung und Steuererlass (§ 34c Abs. 5 EStG)
3. Körperschaftsteuer
4. Gewerbesteuer
§ 3 Die beschränkte Steuerpflicht im Ertragsteuerrecht
A. Persönliche Steuerpflicht
I.Einkommensteuer
Читать дальше