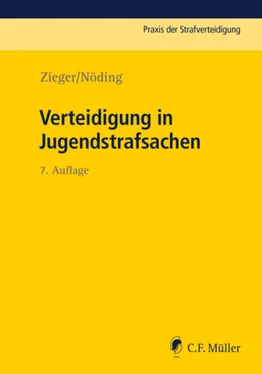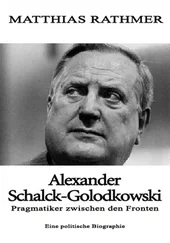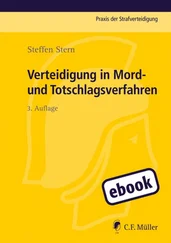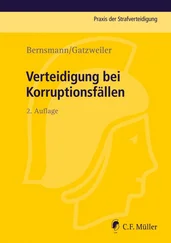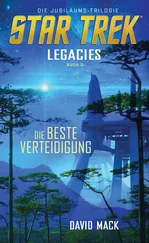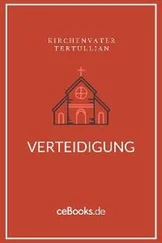17
Kurzer Erwähnung bedarf in diesem Zusammenhang noch die Spielsucht, in der psychiatrischen Krankheitslehre katalogisiert als „pathologisches Spielen“. Häufig wird der den zur Aburteilung stehenden Taten zugrundeliegende Geldbedarf nicht hinterfragt. Gerade bei Heranwachsenden nimmt aber die Zahl derjenigen, die alles Geld an Spielautomaten verlieren, zu.[26] Um Auswirkungen für die Schuldfähigkeit i.S.d. §§ 20, 21 StGB zu erlangen („schwere seelische Abartigkeit“), reicht aber allein chronisches Spielen nicht aus. Maßgebend ist vielmehr, inwieweit das gesamte Erscheinungsbild des jungen Täters bei Zugrundelegung der in der Literatur aufgeführten Beurteilungskriterien psychische Veränderungen der Persönlichkeit aufweist, die in ihrem Schweregrad der krankhaften seelischen Störung gleichwertig sind. Die maßgeblichen Kriterien des ICD 10 und des DSM-IV-TR sind: Spielen wird zum zentralen Lebensinhalt, es tritt Kontrollverlust ein, die Einsätze, Gewinne und Verluste werden gesteigert, ohne Spielen treten entzugsähnliche Erscheinungen auf, trotz hoher Verluste kann der Betroffene nicht aufhören und muss die Verluste zurückgewinnen, er ist zur Abstinenz nicht in der Lage, zieht sich aus seinem sozialen Umfeld zurück, gibt alle anderen Interessen auf und begeht Handlungsweisen, die einer bewussten Selbstbeschädigung gleich kommen.[27]
Teil 1 Jugenddelinquenz und Jugendstrafrecht› III. Problemgruppen, Problemkonstellationen› 3. Einfluss der Medien
18
Unter dem Eindruck der Amokläufe von Schülern (Erfurt am 26.4.2002, Emsdetten 20.11.2006, Winnenden 11.3.2009)[28] und der Berichte über Vorbereitungen zu entsprechenden Taten in anderen Städten ist die Diskussion über den Einfluss der Medien durch Gewaltdarstellungen in Film, Fernsehen, Videos und Computerspielen wieder entbrannt. Die Täter hatten jedenfalls auch zu gewaltverherrlichenden Computerspielen Kontakt, so dass sich die Frage stellt, ob vor dem Hintergrund der Fehlverarbeitung des eigenen Versagens und erlittener Kränkungen der Konsum solcher Videos zu Einflüssen oder Abhängigkeiten führt, die extreme Gewaltbereitschaft bewirken. Diese Frage ist bisher nicht schlüssig beantwortet worden. Es wird auch die Auffassung vertreten, dass Gewaltdarstellungen in Medien die tatsächliche gesellschaftliche Gewalt nicht prägt, sondern angesichts der alltäglichen Berichterstattung über (Bürger-)Kriege, Terroranschläge und blutige Taten nur spiegelt.[29] Zwar ist ein direkter Kausalzusammenhang zwischen dem Konsum von Gewaltvideos und eigenem gewalttätigen Verhalten bisher nicht nachgewiesen, wohl aber die signifikant zunehmende Akzeptanz „männlicher“ Gewalt durch Jungen, die am Computer Kampfspiele austragen.[30]
Horror- oder Gewaltvideos können aber im Einzelfall, insbesondere bei einer vernachlässigten oder gestörten Persönlichkeit, das Verhalten und die Schuldfähigkeit beeinflussen. So hat ein erst 14 Jahre alter Täter Horrorszenen eines Videos, in dem der „Held“ seinen Feinden den Kopf zertrümmert, nachgespielt und seine Verwandten damit zu erschrecken versucht. Als er befürchtete, sich sonst lächerlich zu machen, verletzte er u.a. seine Cousine mit dem Beil am Kopf. Ihm wurde eine zur Anwendung der §§ 20, 21 StGB führende Sucht anerkannt, Horror-Videos zu sehen, sich in die dort gezeigten Rollen hineinzuversetzen und den Bezug zur Realität derart zu verlieren, dass er die Anerkennung der angenommenen Rolle aus der Horror-Phantasiewelt mit Gewalt durchsetzte. Dieser Ansatz ist allerdings fraglich. Insbesondere bei sehr jungen Tätern wird man viel eher an fehlende Verantwortungsreife, § 3 Satz 1 JGG, denken müssen. Ein junger Beschuldigter, der sich so sehr selbst überlassen ist, dass er regelmäßig Horror-Videos konsumiert und das Gesehene spielend nacherlebt, dürfte kaum eine seinem Entwicklungsstadium angemessene elterliche Beaufsichtigung und Erziehung genießen. Wer seine Umwelt notfalls mit Gewalt dazu bringen will, die Schreckensrolle, die er spielen will, anzuerkennen, dürfte Zweifel an seiner Verantwortungsreife wecken.[31]
Ob man den wiederholten exzessiven Konsum von Gewaltvideos überhaupt als „Sucht“ ansehen kann, ist fraglich.[32] Dies wird aber von Suchtforschungsstellen neuerdings bejaht. Suchtgefahr besteht, wenn der Jugendliche keine Freunde mehr trifft, kein anderes Hobbys kennt, über dem Computerspiel Verabredungen und Pflichten im Haushalt vergisst, die Hausaufgaben vernachlässigt, der Videokonsum sich immer mehr steigert, er sich an Absprachen mit seinen Eltern über die Computernutzung nicht mehr hält und verbal oder sogar körperlich aggressiv reagiert, wenn er weniger Computer spielen soll.[33]
Teil 1 Jugenddelinquenz und Jugendstrafrecht› III. Problemgruppen, Problemkonstellationen› 4. Junge Ausländer, Aussiedler und Flüchtlinge
4. Junge Ausländer, Aussiedler und Flüchtlinge
19
In der Kriminologie ist es eine Binsenweisheit, dass der sich aus den Polizeistatistiken ergebende Eindruck, ausländische Jugendlicheseien generell stärker, nämlich zwei- bis dreifach mehr kriminell belastet als gleichaltrige deutsche Jugendliche, fragwürdig ist. Dies nicht nur deshalb, weil sich bereits in den Verurteiltenzahlen eine deutliche Nivellierung abzeichnet, sondern auch, weil die Vergleichsgruppenbetrachtung angesichts unterschiedlicher Zusammensetzung ungeeignet ist[34] und ein nicht unbeträchtlicher Teil der von der Polizeistatistik erfassten Straftaten solche sind, die nur von Ausländern begangen werden können (Verstöße gegen das Ausländerrecht).
Betrachtet man die Lebensumstände vieler junger Ausländer („Gastarbeiterkinder der zweiten oder dritten Generation“), ist festzustellen, dass bei ihnen strukturell eine Häufung solcher Umstände vorliegt, die nach aller Erfahrung eher dazu führen, dass junge Menschen in Straftaten verwickelt werden: unvollständige Familien (ein Elternteil lebt z.B. im Ausland), Pendelerziehung zwischen Angehörigen im Ausland und hier lebenden Elternteilen, manchmal Übersiedlung aus allein aufenthaltsrechtlichen Gründen erst kurz vor dem 16. Lebensjahr, enge Wohnverhältnisse für vielköpfige Familien, weitgehender Ausfall der Eltern als Erziehungspersonen, weil beide angesichts der wirtschaftlichen Notsituation berufstätig sein müssen, Überforderung der älteren Geschwister mit der Sorge für die jüngeren Kinder. Das Erlernen sozialer Muster nach dem Vorbild der erwachsenen Erziehungspersonen wird erschwert, weil junge Ausländer erleben, dass ihre Eltern ihrerseits den sozialen Anforderungen der hiesigen Gesellschaft nicht gerecht werden, sie beruflich oder in der Durchsetzungsfähigkeit gegenüber Behörden oder Mitbürgern versagen. Junge Ausländer müssen sich mit verschiedenen Kulturen und Identitäten auseinandersetzen, zum einen den herkömmlichen Werten, wie sie meist noch in den Familien intern vertreten werden, zum anderen den Anforderungen der deutschen Gesellschaft, mit denen sie im Umgang mit Freunden, auf der Straße, bei Behörden und vor allem in der Schule konfrontiert werden. Damit ist oft verbunden, dass sie sich weder in ihrer Heimat- noch in der deutschen Sprache wirklich fehlerfrei verständigen können. Die Situation wird verschärft durch vielfach schlechte rechtliche Rahmenbedingungen, insbesondere wenn wegen der ungeklärten aufenthaltsrechtlichen Situation Schwierigkeiten bestehen, eine Arbeitserlaubnis zu erlangen.[35] Ähnliche Problemkonstellationen sind bei jungen Aussiedlern festzustellen.[36]
19a
Mit der im Jahr 2015 einsetzenden Flüchtlingskrise und der „Grenzöffnung“ aus dem September 2015 trat die Gruppe der jugendlichen und heranwachsenen – oft unbegleiteten – Flüchtlingeverstärkt in den Fokus.[37] Bei dieser Gruppe stellen sich die oben angerissenen Probleme in besonderem Maße: In den meisten Fällen sind diese Jugendlichen familiär und kulturell entwurzelt, haben traumatische Fluchterlebnisse hinter sich[38] und leben hier bis zu ihrer (teils auch nur zeitlich begrenzten) aufenthaltsrechtlichen Anerkennung mit unklarer Perspektive in schwierigsten Wohnverhältnissen ohne erwachsene Bezugspersonen. Obwohl in der medialen Berichterstattung aus dieser Gruppe heraus begangene Straftaten teils überzeichnet, dramatisierend und manchmal auch schlicht falsch[39] dargestellt werden, zeigen aktuelle statistische Erhebungen, dass der Anteil delinquenter jugendlicher und heranwachsender Flüchtlinge – vor allem bei Rohheitsdelikten – überproportional zu sein scheint.[40] Berichte über entsprechende Straftaten – zum Beispiel nach den sexuellen Übergriffen in der Kölner Silvesternacht 2015/2016 – und über die überproportionale hohe Kriminalität junger Ausländer und Aussiedler geben immer wieder Anlass zu erregten tagespolitischen Debatten und dem Ruf nach Verschärfungen im Straf- und Ausländerrecht. Bei den entsprechenden Diskussionen darf aber nicht aus dem Blick geraten, dass die überproportionale statistische Präsenz der Straftaten solcher Flüchtlinge zum Teil auch darauf zurückzuführen ist, dass die Gruppe der männlichen 14- bis unter 30-Jährigen, bei denen (Gewalt-)Straftaten besonders häufig vorkommen, unter den Flüchtlingen deutlich überrepräsentiert ist. Bezeichnend ist darüber hinaus auch, dass Flüchtlinge aus Ländern, die hier keine Aussicht auf einen gesicherten Aufenthaltsstatus haben oder deren Asylanträge bereits abgelehnt wurden, überproportional oft strafrechtlich in Erscheinung treten, während Flüchtlinge aus anerkannten Kriegsgebieten, die mit der Zuerkennung eines entsprechenden Schutzstatus rechnen können, deutlich seltener der Fall ist. Zu beachten ist schließlich, dass jedenfalls die Gewaltstraftaten sich zu einem großen Teil gegen andere (meist männliche) Flüchtlinge richten und ersichtlich auf in den beengten und emotional aufgeladenen Wohnverhältnissen der Flüchtlingsunterkünfte entstandene Konflikte zurückgehen.[41]
Читать дальше