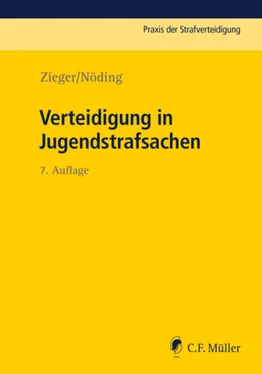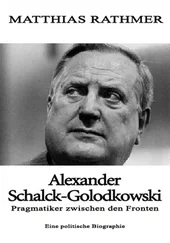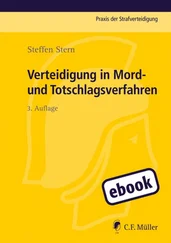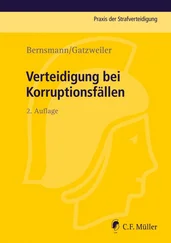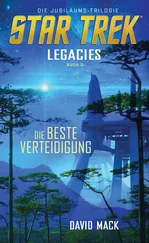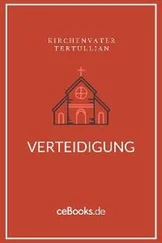[1]
Palentien/Göbel ZJJ 2004, 239, diskutieren in diesem Zusammenhang die Jugendarmut als eine der Ursachen von Jugendkriminalität.
[2]
Backmann DVJJ-Journal 2002, 34; Brunner/Dölling JGG, 17, 19, 23 ff. zu Einf.; Streng Jugendstrafrecht, Rn. 15; Eisenberg 55 ff. zu § 5 JGG; Feltes/Putzke Kriminalisitik 2004, 529; Heitmeyer Kinder- und Jugendkriminalität, S. 25 ff.; Schaffstein/Beulke/Swoboda Jugendstrafrecht, Rn. 47 ff.; Schumann Jugendkriminalität und die Grenzen der Generalprävention, S. 81 ff.; Schumann/Prein/Seus DVJJ-Journal 1999, 301; Walter/Neubacher Jugendkriminalität, Rn. 135 ff.
[3]
Huck DVJJ-Journal 2002, 187; Thomas ZRP 1999, 193; Wassermann NJW 1998, 2097; zu strafprozessualen Maßnahmen gegen strafunmündige Personen: Verrel NStZ 2001, 284; zur erkennungsdienstlichen Behandlung von Kindern: Apel/Eisenhardt StV 2006, 490; zur Strafbarkeit der Eltern nach § 171 StGB: LG Bremen StV 2000, 501; Neuheuser NStZ 2000, 174; zur diesbezüglichen Kriminalprävention Holthusen/Hoops ZJJ 2012, 23.
Teil 1 Jugenddelinquenz und Jugendstrafrecht› III. Problemgruppen, Problemkonstellationen
III. Problemgruppen, Problemkonstellationen
Teil 1 Jugenddelinquenz und Jugendstrafrecht› III. Problemgruppen, Problemkonstellationen› 1. Gruppendelikte
9
Die zentrale Rolle der Gleichaltrigengruppewurde bereits erwähnt.[1] Aus ihr heraus entstehen eigene Wertvorstellungen und Zielsetzungen, oft in bewusster Opposition zu denen der Erwachsenenwelt. Der Einzelne unterwirft sich bewusst oder unbewusst dem Gruppen-Über-Ich, beteiligt sich aktiv, oft überschießend, an der Verwirklichung der Gruppenziele, um Anerkennung zu erlangen oder seinen Rang in der Gruppe zu festigen. Typisch ist es, wenn ein junger Mandant im Verteidigergespräch auf die Frage, warum er sich an der Gruppenstraftat beteiligt hat, nichts anderes vorzubringen weiß als: „Ich konnte doch nicht anders“. Selbstbewusstsein, Durchsetzungsvermögen, Vertreten der eigenen Meinung und der eigenen Wertvorstellungen – das sind Eigenschaften, die erlernt werden müssen, was jungen Menschen gerade in einer Gruppe besonders schwer fällt.
10
Gruppen entfalten damit eine Gruppendynamik, welche die jungen Gruppenmitglieder zu Handlungen verleitet, die sie als Einzelne niemals begehen würden, die persönlichkeitsfremd erscheinen, die in ihrer Spontaneität, oft auch in ihrer Brutalität die einzelnen Teilnehmer später selbst erschrecken. Der Gruppeneinfluss führt zu gruppenkonformem Verhalten, zu einer Gleichschaltung der Interessen und Motive, verstärkt vorhandene Tendenzen, verleitet zu Aktionismus, enthemmt die Mitglieder, die – ohne sich dies bewusst zu machen – ihre Verantwortlichkeit an die übergeordnete Instanz der Gruppe abtreten. Wie weit dies gehen kann, beweist die Tatsache, dass brutale Aufnahmerituale einer Jugendbande von dem jungen „Bewerber“ „freiwillig“ hingenommen wurden; hier bestand im strafrechtlichen Verfahren Veranlassung zur Prüfung, ob die Fähigkeit in die erlittenen Misshandlungen einzuwilligen, nicht durch den Gruppeneinfluss aufgehoben war.[2] Die Auswirkungen der Gruppendynamik gehen oft so weit, dass sie bei jüngeren Tätern die Verantwortungsreife (§ 3 JGG) in Frage stellen können. Bei älteren Tätern und sogar bei Erwachsenen drängt sich manchmal die Prüfung auf, ob Schuldunfähigkeit oder verminderte Schuldfähigkeit (§§ 20, 21 StGB) vorlag. Die Analyse des Gruppenverhaltens hat weiter Bedeutung dafür, ob die Voraussetzungen für die Jugendstrafe (§ 17 JGG, schädliche Neigungen oder Schwere der Schuld) zu bejahen sind.[3] Gruppendelinquenz ist typisch jugendtümlich, legt die Anwendung von Jugendstrafrecht auf Heranwachsende (§ 105 JGG) nahe[4] und hat für die Bemessung der Sanktion Bedeutung.[5]
11
Jugendtümlich ist auch der Zusammenschluss in Jugendbanden, „Gangs“ oder Cliquen. Auch wenn sich diese Gruppierungen manchmal – und dann durchaus medienwirksam – mit schönen Namen schmücken („fighters“, „36er boys“), ändert dies nichts daran, dass diese Gruppierungen regelmäßig keine sehr feste Struktur haben, sondern dass hier, ohne dass eine festgefügte Hierarchie festgestellt werden kann, eine Anzahl junger Menschen in wechselnder Beteiligung Straftaten begeht, denen oft Imponiergehabe gegen rivalisierende Gruppierungen, Verteidigung des eigenen „Reviers“, sonst aber all die Motive zugrunde liegen, die auch sonst für Gruppendelikte zutreffen. Straftaten entstehen auch hier meist aus dem Gruppenzusammenhang ohne genaue Tatplanung oder Klärung der Rollenverteilung, sind getragen von einem unbedingten Solidaritätsgefühl der Gruppenmitglieder, wobei in dieser Konstellation häufiger Delikte, die aus der direkten Konfrontation mit der diese Gruppierungen besonders beobachtenden Polizei entstehen, begangen werden (Widerstand gegen die Staatsgewalt). Solche Jugendbanden geben den Mitgliedern Gelegenheit sich zu zeigen und gesehen zu werden, anerkannt und respektiert zu werden als Mitglied der „Gang“ und jeweils mit den besonderen Stärken, als „fighter“, „dancer“ oder „tagger“ (Bühnen- oder Forumeffekt). Gruppenbildungen dieser Art haben vor allem für Jugendliche aus sozial benachteiligten Schichten, insbesondere auch für Ausländer, eine große Anziehungskraft, wobei zusätzlich gesellschaftliche Erfahrungen, etwa mit dem alltäglichen Rassismus in der Gesellschaft, diese Gruppenbildung begünstigen. Die problematische Rechtsstellung sowie die Ablehnung durch einen Teil der Umwelt werden in der Geborgenheit der Clique kompensiert.[6] Die Gruppe fühlt sich anderen überlegen, was sich auch darin zeigt, dass Geschädigte oft über das eigentlich zur Tatbegehung erforderliche Maß hinaus gedemütigt werden (es wird z.B. auf den bereits am Boden liegenden, besiegten Gegner noch eingetreten). Aus diesem Zusammenhang heraus erklärt sich auch warum in der Jugendszene, vor allem unter gewaltgeneigten Jugendlichen, die Bezeichnung als „Opfer“ eine schwere Beleidigung darstellt.
12
Es empfiehlt sich also, immer dann wenn es Anhaltspunkte für ein Gruppendelikt gibt, zu prüfen, in welcher Weise die Gruppe oder die ihr innewohnende Dynamik in einer Weise Einfluss auf den jungen Mandanten genommen hat, dass dies – zumal nach zwischenzeitlicher Lösung von der Gruppe und Einordnung in andere, positivere Zusammenhänge – zu seinen Gunsten geltend gemacht werden kann. Insbesondere Cabanis [7] hat hier eine praktisch gut verwendbare Übersicht über Anhaltspunkte für und Erscheinungsformen von Gruppendynamikherausgearbeitet.
Kurz gefasst kennzeichnen danach folgende Eigenschaften die durch Gruppendynamik bedingte gemeinsame Tatbegehung:
| • |
schnelle, auf einem spontanen Einfall beruhende, planlos und sich erst aus dem Tatgeschehen heraus selbst entwickelnde Tatbegehung, oft ohne jede verbale Verständigung, |
| • |
Skrupel- und Hemmungslosigkeit der Gruppenmitglieder bis hin zu schweren Verbrechen aus nichtigem Anlass, |
| • |
Entwertung des alten, schwachen, gebrechlichen, homosexuellen oder zu einer gesellschaftlichen Randgruppe gehörenden Opfers, |
| • |
äußere Zweck- und Sinnlosigkeit der Tathandlung (Unverhältnismäßigkeit zwischen Straftat und erhofftem oder erlangtem „Gewinn“), |
| • |
mangelndes Unrechtsbewusstsein und fehlendes Verantwortungsgefühl der Gruppentäter, |
| • |
großes Solidaritätsgefühl und Gefühl der Gruppenüberlegenheit, |
| • |
unklare oder undurchsichtige Rollenverteilungen. |
S. Muster 7 Rn. 274 , Antrag auf Begutachtung zur Schuldfähigkeit bei Gruppendynamik.
Читать дальше