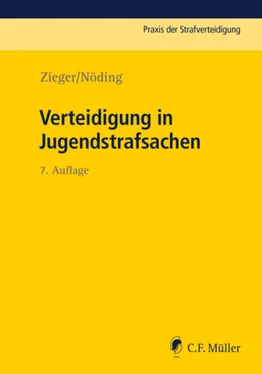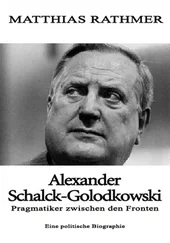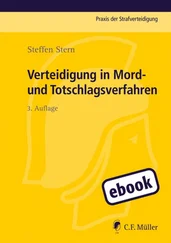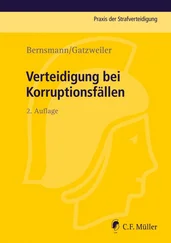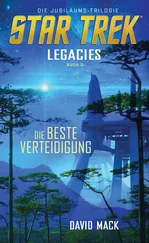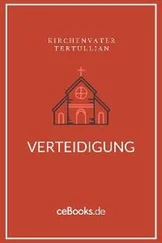1. Grundsätze, Rangfolge
2.Erziehungsmaßregeln
a) Weisungen
b) Hilfe zur Erziehung
3. Zuchtmittel
a) Verwarnung
b) Auflagen
c)Jugendarrest
aa) Arrest nach § 16 JGG
bb) Koppelungsarrest nach § 16a JGG
4.Jugendstrafe
a) Voraussetzungen der Jugendstrafe
aa) Schädliche Neigungen
bb) Schwere der Schuld
b) Bemessung der Jugendstrafe
c) Nichtanrechnung der Untersuchungshaft
d) Strafaussetzung zur Bewährung
e) Vorbehalt der nachträglichen Entscheidung über die Bewährungsaussetzung nach §§ 61 ff. JGG (ehemals „57er-Entscheidung“, „Vorbewährung“)
f) Korrektur eines die Bewährung ablehnenden Urteils
g) Bewährung ohne Strafe, „27er-Entscheidung“
5. Einheitsstrafe
6.Maßregeln
a) Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt
b) Führungsaufsicht
c) Entziehung der Fahrerlaubnis
d)Sicherungsverwahrung
aa) Primäre Sicherungsverwahrung
bb) Vorbehaltene Sicherungsverwahrung
cc) Nachträgliche Sicherungsverwahrung
7.Nebenstrafen/Nebenfolgen
a) Fahrverbot
b) Einziehung
8. Kosten und Auslagen
IV. Anwendung des Jugendstrafrechts auf Heranwachsende
1. Jugendverfehlung
2. Reiferückstand
3. Das auf Heranwachsende anwendbare Jugendstrafrecht
4.Milderungsmöglichkeit bei Anwendung des Erwachsenenstrafrechts auf Heranwachsende
a) Herabsetzung der lebenslangen Freiheitsstrafe
b) Sicherungsverwahrung
c) Nichteintritt von Nebenfolgen
V. Straftaten in unterschiedlichen Alters- und Reifestufen
Teil 3 Die Beteiligten des Jugendstrafverfahrens, ihre Rechtsstellung, Zuständigkeiten und Aufgaben
I. Der junge Beschuldigte
II. Eltern und Erziehungsberechtigte
III. Polizei
IV. Jugendstaatsanwalt
V. Jugendgerichtshilfe
VI. Jugendrichter, Zuständigkeiten der Jugendgerichte
VII. Jugendschöffen
VIII. Sachverständige
IX. Bewährungshelfer
X. Verteidiger
Teil 4 Diversion und Verfahrenseinstellung, §§ 45, 47 JGG
I. Begriff, Rechtsgrundlagen, Abgrenzung zur Verfahrenseinstellung nach StPO
II. Erscheinungsformen der Diversion
1. Absehen von Verfolgung durch den Staatsanwalt im Ermittlungsverfahren nach §§ 45 Abs. 1 JGG, 153 StPO
2. Absehen von Verfolgung durch den Staatsanwalt im Ermittlungsverfahren mit Rücksicht auf andere erzieherische Maßnahmen, § 45 Abs. 2 JGG
3. Absehen von Verfolgung mit Rücksicht auf eine vom Staatsanwalt angeregte ambulante jugendrichterliche Maßnahme: formloses jugendrichterliches Erziehungsverfahren, § 45 Abs. 3 JGG
4. Einstellung durch den Jugendrichter, § 47 JGG
III. Rechtspraxis
IV. Gefahren der Diversion
Teil 5 Verteidigung im Jugendstrafverfahren
I. Mandatsannahme
II. Pflichtverteidigung, § 68 JGG, § 140 StPO
III. Verteidigung im Vorverfahren
1. Verteidigungsgespräche mit dem jungen Mandanten und seinen Eltern
2. Kontakt zur Jugendgerichtshilfe, Bezugspersonen oder Einrichtungen
3. Erarbeitung der Verteidigungsstrategie
4. Bemühen um Einstellung/Diversion
IV. Vorläufige Anordnungen über die Erziehung, einstweilige Unterbringung, Untersuchungshaft
1. Vorläufige Anordnungen über die Erziehung, einstweilige Unterbringung
2.Untersuchungshaft
a) Dringender Tatverdacht und Haftgründe
b) Subsidiaritätsprinzip, Verhältnismäßigkeit
c) Bemühen um Haftvermeidung
d) Untersuchungshaftvollzug
V. Verteidigung im Zwischenverfahren
VI. Verteidigung in der Hauptverhandlung
1. Besondere Vorbereitungspflicht des Verteidigers
2.Sonderbestimmungen für die Hauptverhandlung in Jugendstrafsachen
a) Einstellung des Verfahrens
b) Öffentlichkeit
c) Presse- und Bildberichterstattung
d) Junge Zeugen
e) Vereidigung von Zeugen
f) Abwesenheitsverhandlung, zeitweiliger Ausschluss des Angeklagten
g) Besondere Anforderungen an die schriftlichen Urteilsgründe
h) Besondere Anforderungen an Belehrungen
i) Anwesenheits- und Verfahrensrechte von Eltern, Jugendgerichtshilfe und Bewährungshelfer
j) Anwendungsbesonderheiten
3. Schlussvortrag des Verteidigers
VII. Verständigung und Absprache
VIII. Rechtsmittel
IX. Besondere Verfahrensarten
1. Vereinfachtes Jugendverfahren, §§ 76–78 JGG
2. Privat- und Nebenklage, Adhäsionsverfahren
3. Junge Angeklagte vor Erwachsenengerichten, §§ 102, 103 Abs. 2, 104 JGG
4. Strafbefehlsverfahren
5. Beschleunigtes Verfahren
6. Verfahren bei Ordnungswidrigkeiten
Teil 6 Strafvollstreckung, Strafvollzug, Register
I. Strafvollstreckung
1. Verteidigung im Vollstreckungsverfahren
2. Der Jugendrichter als Vollstreckungsleiter
3. Aussetzung der Restjugendstrafe zur Bewährung, Führungsaufsicht bei Vollverbüßung
4. Abgabe der Vollstreckung an die Staatsanwaltschaft
II. Jugendstrafvollzug
1. Rechtsgrundlagen
2. Praxis des Jugendstrafvollzuges
3. Rechtsschutz im Jugendstrafvollzug
4. Herausnahme aus dem Jugendstrafvollzug, Hereinnahme in den Jugendstrafvollzug
III. Straf- und Erziehungsregister, Beseitigung des Strafmakels
Teil 7 Muster von Verteidigungsanträgen
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Teil 1 Jugenddelinquenz und Jugendstrafrecht
Inhaltsverzeichnis
I. Die „Normalität“ von Jugenddelinquenz
II. Ursachen der Jugendkriminalität
III. Problemgruppen, Problemkonstellationen
IV. Die Effektivität des Jugendstrafrechts
Teil 1 Jugenddelinquenz und Jugendstrafrecht› I. Die „Normalität“ von Jugenddelinquenz
I. Die „Normalität“ von Jugenddelinquenz
1
Dem Jugendstrafrecht liegt die Erkenntnis zugrunde, dass Straftaten junger Täter weitgehend Ausdruck der schwierigen Umorientierungsphase in Pubertät und Adoleszenz sind. Sie sind von daher „normal“, auf sie soll deshalb möglichst nur mit erzieherisch wirkenden Mitteln reagiert werden. Sie lassen sich in allen gesellschaftlichen Gruppen unabhängig von Schichtzugehörigkeit oder Nationalität feststellen, sind also allgegenwärtig („ubiquitär“). Diese Verhaltensweisen enden meist auch dann wenn sie nicht entdeckt und ihnen nicht mit den Mitteln des Jugendstrafrechts entgegengetreten wird, von selbst, wenn der Reifungsprozess abgeschlossen, Sozialverhalten erlernt und die persönliche Situation durch Arbeitsaufnahme und/oder Familiengründung stabilisiert ist. Jugenddelinquenz ist also ganz überwiegend eine vorübergehende Erscheinung, ist „passager“ bzw. „episodenhaft“. Die statistischen Zahlen erweisen einen rasanten Anstieg der Kriminalitätsbelastung vom 14. bis zum 21./22. Lebensjahr und danach ein deutliches, kontinuierliches Absinken mit zunehmendem Lebensalter. Bei jungen Männern steigt die Kurve der Kriminalitätsbelastung zwischen dem 14. und dem 21. Lebensjahr von Null (Strafunmündigkeit) auf knapp 8 % an, und senkt sich dann auf 3 % bis zum 50. Lebensjahr. Junge Frauen haben zwar insgesamt eine deutlich geringere Kriminalitätsbelastung aufzuweisen, aber auch dort steigt die Kurve zwischen dem 14. und dem 21. Lebensjahr von Null auf etwa 2 %, um dann bis zum 50. Lebensjahr auf 1 % zurückzugehen. Der ganz überwiegende Teil der im Jugendalter episodenhaft auftretenden Deliquenz ist dabei der sog. Bagatellkriminalität zuzuordnen. Diese allgemein anerkannten, auch in den einschlägigen Kommentaren berücksichtigten und von der Rechtsprechung durchaus erkannten und vor allem in der Diversionspraxis verarbeiteten kriminologischen Erkenntnisse sind heute, trotz aller Bewertungen im Einzelnen, unbestritten.[1] Sie werden durch die Polizei- und Rechtspflegestatistiken zu den Tatverdächtigen- bzw. Verurteiltenzahlen[2] ebenso belegt wie durch die Ergebnisse der Dunkelfeldforschung.[3] Jeder Einzelne wird, wenn er sich ohne Verdrängung an seine eigene Jugend oder an Erlebnisse mit Jugendlichen aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis erinnert, dies aus eigener Erfahrung bestätigen können.
Читать дальше