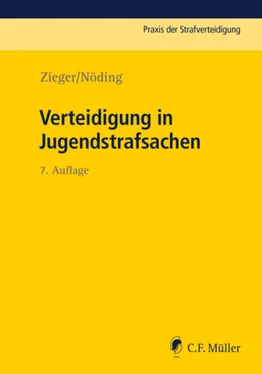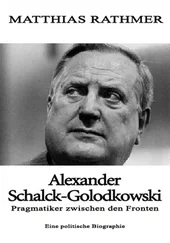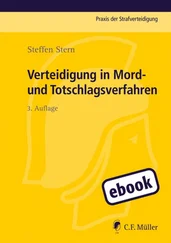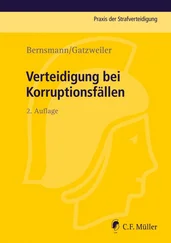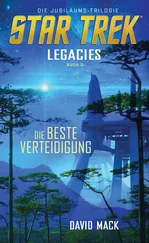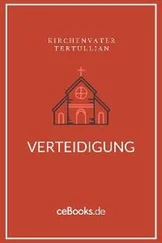[1]
Albrecht Jugendstrafrecht, S. 2 ff.; Brunner/Dölling JGG, 5 ff. zu Einf.; Meier/Rössner/Schöch § 3 Rn. 6 ff.; Schaffstein/Beulke/Swoboda Jugendstrafrecht, Rn. 17 ff.; Spiess Jugendkriminalität in Deutschland – zwischen Fakten und Dramatisierung, S. 21. Ostendorf/Drenkhahn Jugendstrafrecht, Rn. 2 ff.; Boers u.a. NK 2010, 58; Dollinger/Schmidt -Semisch Handbuch Jugendkriminalität, S. 4; Dollinger/Schmidt-Semisch/ Schumann Handbuch Jugendkriminalität, S. 261; Boers Internationales Handbuch der Kriminologie, Bd. 2, S. 577 ff.; Stemmler/Wallner/Weiss in: Festschrift Streng, S. 627.
[2]
Albrecht Jugendstrafrecht, S. 2 ff.; Backmann DVJJ-Journal 2002, 34; Laubenthal/Baier/Nestler Jugendstrafrecht, Rn. 7 ff.; Ostendorf Grdl. 7 ff. zu §§ 1–2 JGG; Schaffstein/Beulke/Swoboda Jugendstrafrecht, Rn. 38 ff.
[3]
Albrecht Jugendstrafrecht, S. 16 ff.; Brunner/Dölling JGG, 5 zu Einf.; Walter/Neubacher Jugendkriminalität, Rn. 377 ff.
[4]
Walter/Neubacher Jugendkriminalität, Rn. 377 ff.; Deutsches Jugendinstitut (DJI) Zahlen, Daten, Fakten zu Jugendgewalt (Stand: Juli 2017), abrufbar unter https://www.dji.de.
[5]
Walter/Neubacher Jugendkriminalität, Rn. 553.
[6]
Albrecht Jugendstrafrecht, S. 78 ff.; Dollinger/Schmidt-Semisch/ Reuband Handbuch Jugendkriminalität, S. 259 .
[7]
Eisenberg 9 zu § 45, 7 zu § 71, 3 zu § 72 JGG; Ostendorf 24 zu § 5 JGG.
[8]
Vgl. Brunner/Dölling JGG, 41 zu Einf.; zu Mehrfach- und Intensivtäter noch ausführlich unten, Rn. 21 f.
[9]
Albrecht Jugendstrafrecht, S. 37 ff.; Huck DVJJ-Journal 2002, 187; Löhr ZRP 1997, 280 (281); Schaffstein/Beulke/Swoboda Jugendstrafrecht, Rn. 21 ff.; Schallert DVJJ-Journal 1998, 17; Walter/Neubacher Jugendkriminalität, Rn. 461 ff., 485 f.
[10]
Spiess Jugendkriminalität in Deutschland – zwischen Fakten und Dramatisierung, S. 21.
[11]
Albrecht Jugendstrafrecht, S. 8 ff.; Walter/Neubacher Jugendkriminalität, Rn. 434 ff.
[12]
Zur Strafbarkeit des sog. Sextings Hüneke ZJJ 2016, 135; zum sog. Cybergrooming Mathiesen Cybermobbing und Cybergrooming, passim.
[13]
Pfeiffer/Baier/Kliem Zur Entwicklung der Gewalt in Deutschland – Jugendliche und Flüchtlinge als Täter und Opfer, S. 61 bis 68, abrufbar unter: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/zur-entwicklung-der-gewalt-in-deutschland-/121148.
[14]
Vgl. Dantschke ZJJ 2015, 43; Matt ZJJ 2017, 252; Leuschner ZJJ 2017, 257.
[15]
Hinz ZRP 2001, 106 (108 ff.); Höyink/Sommer ZRP 2001, 245 (246 f.); Schwind ZRP 1999, 107; s. a. Rn. 39.
[16]
Pfeiffer/Baier/Kliem Zur Entwicklung der Gewalt in Deutschland – Jugendliche und Flüchtlinge als Täter und Opfer, passim; Antholz FPPK 2017, 81; Albrecht RdJB 2016, 395 ; Dölling/Hermann/Laue/Weninger FPPK 2014, 72; Baier/Pfeiffer/Hanslmaier ZJJ 2013, 279; Lösel in: Festschrift Streng, 2017, S. 539.
[17]
Brunner/Dölling JGG, 13 zu Einf.
[18]
Damit sollen solche Taten nicht bagatellisiert werden. Denn Opfer des Handtaschenraubs sind oft ältere Menschen, bei denen bereits ein Sturz zu erheblichen Verletzungsfolgen führen kann, oder schwächere andere Jugendliche, die eingeschüchtert werden.
[19]
Antholz Neue Praxis (np) 2017, 55; Baier/Prätor FK 2017, 1, 40; Taefi/Görgen/Kraus FK 2013, 3, 53; Baumann u.a. StV 1998, 632; Ostendorff DVJJ-Journal 1999, 19; Neubacher ZRP 1998, 429; Schallert DVJJ-Journal 1998, 17; Schumann/Prein/Seus DVJJ-Journal 1999, 300.
[20]
Jugendstrafrechtsreform-Kommission des DVJJ DVJJ-Journal 2001, 345; Dünkel/Geng/Passow ZJJ 2017, 123.
Teil 1 Jugenddelinquenz und Jugendstrafrecht› II. Ursachen der Jugendkriminalität
II. Ursachen der Jugendkriminalität
7
Die allgemeine Jugenddelinquenz ist nicht monokausal zu erklären. Die unterschiedlichen kriminologischen Erklärungsansätze bergen jeweils für sich Teilwahrheiten. Sicher spielt die körperlich-biologische Entwicklung der jungen Menschen in der Pubertät und vor allem das schnellere körperliche Heranreifen und die daraus folgende Disharmonie zur sonstigen sozialen Entwicklung eine Rolle. Hinzu treten im Prozess des Erwachsenwerdens psycho-soziale Bedingungen und Belastungen, die je nach der sozialen Stellung des jungen Menschen und seiner Eltern und nach der gesamten örtlichen und zeitgeschichtlichen Situation sehr unterschiedliche Gestalt annehmen können. Den jungen Menschen wird zugemutet, die Egozentrik der Kindheit zu überwinden und ihr Sozialverhalten den allgemein anerkannten Normen anzupassen. Es entstehen Verhaltensprobleme, Enttäuschungen und Missverständnisse. Spannungen und Übergangsprobleme rühren oft daher, dass zwar an die Jugendlichen und Heranwachsenden soziale Anforderungen gestellt werden, ihnen aber die soziale Anerkennung und der soziale Aufstieg, die sie bei Erwachsenen sehen, praktisch weitgehend verschlossen bleiben. Die jungen Menschen müssen in Jugend und Adoleszenz nicht nur ihr Wissen und ihr Verhaltensrepertoire erweitern, sie wollen auch eigene Erfahrungen sammeln, das ihnen Vorgegebene in Frage stellen, Protest und Opposition wagen, „Männlichkeit“ und Selbstbewusstsein demonstrieren. Nimmt man die Unerfahrenheit und manchmal sogar Hilflosigkeit junger Menschen hinzu, wird deutlich, dass es hier zu Grenzüberschreitungen bis hin zu Straftaten kommen kann. Welchen Verlauf die Probleme und Konflikte nehmen, in denen sich die Gruppe der 14-21-jährigen befindet, hängt weitgehend von Sozialisation, Familienverhältnissen (gab es genug Zärtlichkeit, Zuwendung und Zeit für die Kinder?), Wohn-, Arbeits- und sonstigen Lebensbedingungen, Erfolg oder Misserfolg bei der Ausbildung und der Frage ab, ob es gelingt, die Freizeit aktiv, selbstbestimmt und konstruktiv zu gestalten. Jugend als Übergangsstadium zwischen Kindheit und Erwachsenenwelt wird zentral auch bestimmt von der Suche nach Geborgenheit und Anerkennung in Gleichaltrigengruppen, die positiven oder schädlichen Einfluss ausüben können. Junge Menschen können die mit dem Anstieg sozialer Gegensätze zunehmende Diskrepanz, zwischen den subjektiven Ansprüchen (von teurer Markenkleidung bis hin zu gehobener Ausbildung) und den fehlenden Möglichkeiten diese durchzusetzen (fehlende Geldmittel, keine abgeschlossene Schulbildung), schwer ertragen.[1]
8
Nach den Erfahrungen der Praxis hat es den Eindruck, als ob vor allem Jugendliche und Heranwachsende gefährdet sind, die mit folgenden Belastungenzu kämpfen haben:
| • |
zerrüttete Familienverhältnisse, unvollständige Familien („broken home“), Ablehnung durch den neuen Lebensgefährten eines Elternteils, |
| • |
„Pendelerziehung“ mit inkonsistentem Erziehungsverhalten der wechselnden Bezugspersonen (Mutter – Großmutter – Onkel – verschiedene Heime – Trebegängerzeiten), |
| • |
abgebrochene Schule, fehlende Ausbildung, längere Arbeitslosigkeit, |
| • |
Gewalt in der Familie, eigene Gewalterfahrungen als Opfer, Suchtprobleme in der Familie, eigene Suchtprobleme, |
| • |
fehlende Anregungen für konstruktives Freizeitverhalten, |
| • |
Abstempelung bzw. Stigmatisierung aufgrund Zugehörigkeit zu einer negativ bewerteten oder benachteiligten Gruppe oder einem entsprechenden (Wohn-)Umfeld, |
| • |
kulturelle Entwurzelung, insb. bei jungen Flüchtlingen und deutschen Jugendlichen mit Migrationshintergrund.[2] |
Ähnliche Hintergründe sind auch bei der Kinderdelinquenzfestzustellen, auf die in erster Linie mit Erziehung und Angeboten der Jugendhilfe (§§ 27 ff. SGB VIII) und nur im Notfall mit Zwangsmitteln des Vormundschaftsgerichts (§§ 1666, 1666a BGB) reagiert werden muss.[3]
Читать дальше