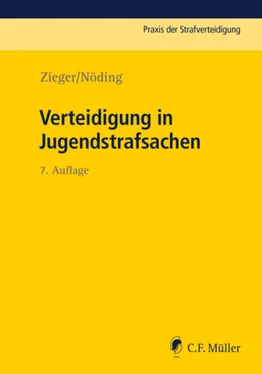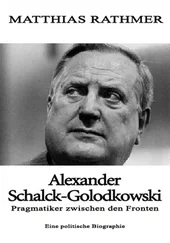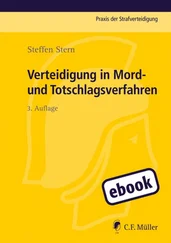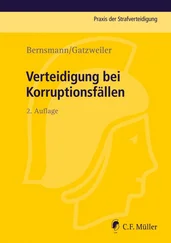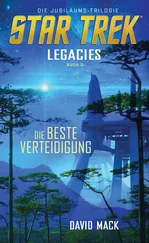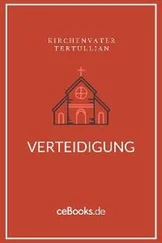Dies sind Widersprüche zwischen Jugend- und Erwachsenenstrafrecht, die materiell und prozessual dem Verbot der Schlechterstellungzu widersprechen scheinen. Aus der generell geringeren Schuld junger Täter, dem Verhältnismäßigkeitsprinzip, dem Grundsatz, dass die Strafe nicht höher sein darf als die Schuld des Angeklagten, und aus der Pflicht, die geringere soziale Kompetenz junger Beschuldigten zu berücksichtigen, wird der Grundsatz hergeleitet, dass Jugendliche im Jugendstrafverfahren materiell und prozessual nicht schlechter gestellt sein dürfen als Erwachsene im Erwachsenenstrafverfahren.[21] Die genannten Vorschriften sind gesetzlich geregelte Ausnahmen von diesem Verbot. Der Verteidiger muss sich deshalb unter Berufung auf das grundsätzliche Verbot der Schlechterstellung bemühen, die Benachteiligungen für seine jungen Mandanten z.B. dadurch gering zu halten, dass er geltend macht, dass das Fehlverhalten, das bei einem Erwachsenen nur zu einer Freiheitsstrafe unter sechs Monaten führen würde, im Jugendstrafrecht dann eben nicht mit Jugendstrafe, sondern nur mit Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln geahndet werden darf,[22] und bei einem nicht geständigen jungen Mandanten muss er verstärkte Bemühungen unternehmen, die Einstellung des Verfahrens wenn nicht nach § 153 StPO i.V.m. § 45 Abs. 1 JGG, so doch zumindest nach § 45 Abs. 2 JGG (Einstellung wegen anderweitiger erzieherischer Maßnahme) oder nach § 153a StPO[23] durchzusetzen, was bei diesen Alternativen auch ohne Geständnis möglich ist. Er hat außerdem die Möglichkeit und die Pflicht, bei der Anwendung der durch Sonderbestimmungen des JGG nicht ausgeschlossenen Verfahrensregeln der StPO (z.B.: Ausgestaltung der Belehrung, Sitzungspolizei) auf eine den Grundsätzen des Jugendstrafrechts und der geringeren sozialen Kompetenz der Angeklagten Rechnung tragende Auslegung hinzuwirken.[24]
38
Per Saldo ist aber das Jugendstrafrecht regelmäßig das günstigere Recht:
| • |
Bei Jugendlichen muss zusätzlich die Verantwortungsreife positiv festgestellt werden (§ 3 JGG), |
| • |
es gibt einen viel größeren Bereich ambulanter und informeller Reaktionsmöglichkeiten (§§ 10, 15, 45, 47 JGG), |
| • |
die Anordnung von Untersuchungshaft ist erschwert (§§ 71 Abs. 2, 72 JGG), |
| • |
der Anwendungsbereich der Pflichtverteidigung ist ausgeweitet (§ 68 JGG), |
| • |
die notwendig zu beteiligende Jugendgerichtshilfe leistet nicht nur dem Gericht Aufklärungs- und Entscheidungshilfe, sondern auch dem jungen Beschuldigten Beratung, Beistand und Hilfe und regt Diversionsmöglichkeiten an (§ 38 JGG, § 52 SGB VIII), |
| • |
es kann auch bei einem Schuldspruch davon abgesehen werden, dem Angeklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (§ 74 JGG), |
| • |
es gibt erweiterte Bewährungsmöglichkeiten (§§ 21, 27, 61 ff. JGG), |
| • |
die Einheitsstrafenbildung (§ 31 Abs. 1 JGG) ermöglicht die Festsetzung einheitlicher Maßnahmen bei tatmehrheitlich begangenen Straftaten unter im Vergleich zur Gesamtstrafenbildung des Erwachsenenstrafrechts deutlich weiteren Anwendungsvoraussetzungen, |
| • |
über die Anwendung des § 31 Abs. 3 JGG können Jugendstrafen nebeneinander gestellt und zur Bewährung ausgesetzt werden, die insgesamt deutlich über dem an sich bewährungsfähigen Strafmaß liegen: Die Restjugendstrafe kann nach Teilverbüßung viel früher zur Bewährung ausgesetzt werden als bei Erwachsenen (§ 88 JGG). |
Deswegen wird sich der Verteidiger regelmäßig für die Anwendung des Jugendstrafrechts einsetzen. Auch in der Rechtsprechung ist anerkannt, dass z.B. dann, wenn das Alter eines jungen Angeklagten nicht sicher festzustellen ist, nach dem Grundsatz „in dubio pro reo“ das Jugendstrafrecht anzuwenden ist.[25]
Das Jugendstrafrecht strahlt zugunsten junger Erwachsenersogar auf das Erwachsenenstrafrecht aus ( „Fernwirkung des Jugendstrafrechts“). Dies folgt zum einen aus § 114 JGG, wonach bis zum 24. Lebensjahr Freiheitsstrafe in einer Jugendstrafvollzugsanstalt vollzogen werden kann.[26] Ansonsten gibt es bei jungen Erwachsenen nach der Rechtsprechung Milderungsmöglichkeiten, beispielweise beim „minder schweren Fall“,[27] bei der Bemessung von Freiheits- oder Geldstrafe,[28] bei der Bewährung oder wenn ein junger Erwachsener eine Tat aus einer Gruppensituation („um nicht als Schwächling dazustehen“) begangen hat.[29]
[1]
Vgl. zur „Angebotslösung“ des SGB VIII und sein Verhältnis zum JGG: Wiesner u.a. 18 ff., 46 ff. vor § 27 SGB VIII; Tammen/Trenczek in: Frankfurter Kommentar, 5 ff., 31 ff. vor § 27 SGB VIII.
[2]
BT-Drucks. 16/6293, S. 10; Diemer/Schatz/Sonnen 1 zu § 2 JGG.
[3]
BGHSt 36, 37; Böhm/Feuerhelm Jugendstrafrecht, § 2; Brunner/Dölling 6 zu Einf.; Eisenberg 5 zu § 5 JGG; Ostendorf 4 f. zu Grdl. zu §§ 1 und 2 JGG; Dölling ZJJ 2012, 124.
[4]
BVerfG NJW 2006, 2093 und dazu Scholz ZJJ 2006, 424.
[5]
Albrecht H.-J. Gutachten; ders. NJW-Beilage 23/2002, 26; Albrecht Jugendstrafrecht, S. 67–78; vgl. auch Eisenberg Einl. 14 zum JGG; Ostendorf 4 zu Grdl. zu §§ 1 und 2 JGG; Pfeiffer DVJJ-Journal 1991, 114; a.A. Brunner/Dölling JGG, 84 f. zu Einf.
[6]
Albrecht H-J. Gutachten; ders. NJW-Beilage 23/2002, 26.
[7]
Albrecht Jugendstrafrecht, S. 136-139; Böhm/Feuerhelm Jugendstrafrecht, § 3, 1.; Löhr ZRP 1997, 230; Ostendorf 2 ff. zu § 5 JGG.
[8]
Eisenberg 3-5 zu § 5 JGG.
[9]
BVerfG NJW 2003, 2004; vgl. auch RhPfVerfGH NJW-RR 2012, 1345.
[10]
Vgl. § 1666 BGB und BVerfG NJW 1988, 45.
[11]
Konkordanz des rechtsstaatlichen Gebots einer funktionstüchtigen Strafrechtspflege ( BVerfGE 36, 186; BVerfGE 77, 76) und des elterlichen Erziehungsrechts, Art. 6 GG.
[12]
Walter/Wilms NStZ 2004, 600; vgl. auch Wedler NStZ 2012, 293.
[13]
RL Nr. 1 zu § 1 JGG; BayObLG NJW 1972, 837; Eisenberg 21 zu § 1 JGG; vgl. auch unten, Rn. 243.
[14]
Einzelheiten, insbesondere zur Zulässigkeit von Polizeimaßnahmen, bei Ostendorf 1-9 zu § 1 JGG; Brunner/Dölling 25-27 zu § 1 JGG; Diemer/Schatz/Sonnen 20-22 zu § 1 JGG; Nix u.a. 2-4 zu § 1 JGG; zur Kinderdelinquenz: Traulsen DVJJ-Journal 1997, 47.
[15]
Vgl. Rn. 13.
[16]
AG Saalfeld NStZ-RR 2004, 264.
[17]
Meier/Rössner/Schöch § 6 Rn. 2 ff.; Ostendorf 10 zu § 1 JGG.
[18]
Dazu ausführlich unten Rn. 96a.
[19]
Böhm/Feuerhelm Jugendstrafrecht, § 3. 2.
[20]
Vgl. unten Rn. 114 f.
[21]
BayObLG NStZ 1991, 584; LG Itzehoe StV 1993, 537; Eisenberg 9a zu § 45 JGG sowie 5 zu § 92 JGG (für den Jugendstrafvollzug); Ostendorf/Drenkhahn Jugendstrafrecht, Rn. 61; Laubenthal/Baier/Nestler Jugendstrafrecht, Rn. 3 ff., 6; Ostendorf 4-6 zu § 5 JGG; widersprüchlich Brunner/Dölling JGG, einerseits 103 zu Einf., andererseits 28 zu § 18 JGG; a.A. BGH StV 1982, 27; Diemer/Schatz/Sonnen 3 zu § 5 JGG; Fahl NStZ 2009, 613; Rössner in: Meier/Rössner/Trüg/Wulf, 30 zu § 2 JGG; Schaffstein/Beulke/Swoboda Jugendstrafrecht, Rn. 575; Scheffler NStZ 1992, 491; zur Problematik der Schlechterstellung jugendlicher und heranwachsender Straftäter aus kriminologischer und empirischer Sicht: Kemme/Stoll MschrKrim 2012, 32.
Читать дальше