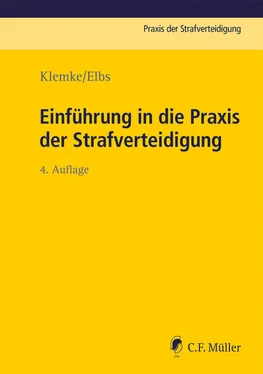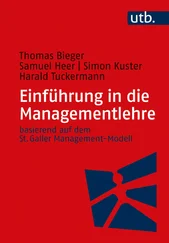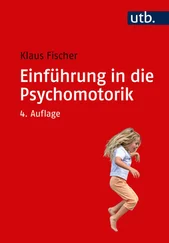Inhaltsverzeichnis
I. Der Wahlverteidiger
II. Die Pflichtverteidigung
III. Zulässiges und unzulässiges Verteidigerhandeln
IV. Die Vergütung des Verteidigers
Teil 1 Das Mandat des Strafverteidigers› I. Der Wahlverteidiger
Teil 1 Das Mandat des Strafverteidigers› I. Der Wahlverteidiger› 1. Der Abschluss des Anwaltsvertrages
1. Der Abschluss des Anwaltsvertrages
1
Das Mandatsverhältnis zwischen dem Wahlverteidiger und seinem Mandanten wird wie jedes andere Vertragsverhältnis auch durch zwei miteinander korrespondierende Willenserklärungen der Vertragsparteien begründet, nämlich durch das Angebot und dessen Annahme (§§ 145 ff. BGB). Der Mandant wird i.d.R. in der Kanzlei des von ihm gewählten Verteidigers erscheinen und ihn bitten, seine Verteidigung zu übernehmen. Ist der Verteidiger hierzu bereit, ist der Anwaltsvertrag wirksam geschlossen.
2
Dies muss noch nicht einmal ausdrücklich geschehen. Es ist durchaus denkbar, dass der Verteidiger die Übernahme des ihm angetragenen Mandates stillschweigend erklärt, indem er für den Mandanten erkennbar nach außen als Verteidiger handelt, z.B. durch die Bestellung zu den Akten und die Beantragung von Akteneinsicht. Ratsam ist dies allerdings nicht. Der Verteidiger sollte die Annahme des Mandates stets ausdrücklich erklären. Nur so können unnötige Streitigkeiten über die Frage, ob überhaupt ein Anwaltsvertrag geschlossen wurde, vermieden werden.
3
Der Verteidiger muss sich bewusst sein, dass der noch jugendliche Mandant keinen wirksamen Anwaltsvertrag abschließen kann. Der Abschluss eines Anwaltsvertrages ist für den jugendlichen Mandanten nicht „lediglich rechtlich vorteilhaft“ i.S.v. § 107 BGB. Selbst wenn über die Vergütung nicht ausdrücklich gesprochen würde, schuldete der jugendliche Auftraggeber seinem Verteidiger nämlich die gesetzliche Vergütung nach dem RVG. Bis zur Genehmigung des gesetzlichen Vertreters ist der Anwaltsvertrag schwebend unwirksam. Nach dem Eintritt der Volljährigkeit des Mandanten kann dieser den Vertragsabschluss genehmigen, § 108 Abs. 3 BGB.[1] Ohne einen wirksamen Anwaltsvertrag muss der Verteidiger befürchten, etwaige vom Jugendlichen direkt erhaltene Vorschüsse gem. §§ 812, 819 BGB zurückzahlen zu müssen.[2]
4
Der Verteidiger muss also im Zuge der Anbahnung des Mandats in jedem Fall das Gespräch mit dem gesetzlichen Vertreter suchen, um sein Einverständnis für den Abschluss eines Anwaltsvertrages zu erlangen. Allerdings hat er sich zuvor vom potentiellen jugendlichen Mandanten von der anwaltlichen Schweigepflicht entbinden zu lassen. Bereits die Tatsache, dass ein Mandatsverhältnis besteht, unterliegt nämlich der anwaltlichen Berufspflicht zur Verschwiegenheit gem. § 43a Abs. 2 BRAO.
5
Erfolgt die Übernahme des Mandats in der Haftanstalt, in der Haftzelle des Amtsgerichts oder am Wohnort des Beschuldigten bei der Durchsuchung und somit nicht in den Kanzleiräumen (vgl. § 312b BGB), werden weitreichende Verbraucherrechte ausgelöst. Zum einen gelten umfangreiche Informationspflichten gem. § 312d Abs. 1 BGB i.V.m. Art. 246a §§ 1, 4 EGBGB und zum anderen haben die Mandanten, die Verbraucher i.S.v. § 13 BGB sind, ein Widerrufsrecht gem. §§ 312g, 355 BGB, das sich nicht abbedingen lässt. Das Verbraucherrecht stellt damit für den klassischen Strafverteidiger, der nicht Unternehmensverteidiger ist, eine in der Praxis kaum zu bewältigende Herausforderung dar. Das Verbraucherrecht ist auf den standardisierten Verkauf von Waren und Dienstleistungen zugeschnitten und nicht auf den Vertragsabschluss zwischen Verteidiger und Beschuldigtem. Zwar sieht § 312g Abs. 2 Satz 1 BGB einige Bereichsausnahmen vor, jedoch irrwitziger weise keine für Rechtsanwälte und deren Dienstleistungen.
6
Gleiches gilt für Fernabsatzverträge nach § 312c BGB. Immer wenn die Vertragsanbahnung und der Vertragsschluss ausschließlich durch Fernkommunikationsmittel (einschließlich gewechselter Briefe) erfolgten, steht dem Verbraucher, d.h. dem Mandanten, ein Widerrufsrecht von 14 Tagen zu. Die Frist läuft erst nach Erteilung der Widerrufsbelehrung.
7
Strenggenommen müsste jeder Verteidiger in derartigen Fällen mit der Bearbeitung zuwarten, bis die Widerrufsfrist verstrichen ist, will er nicht umsonst arbeiten.
8
Diese gesetzlichen Regelungen sind ein schlagender Beweis dafür, dass der Gesetzgeber durch die Überregulierung im Hinblick auf den Verbraucherschutz unnötige Hemmnisse und Risiken nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die freien Berufe geschaffen hat. Für den Strafverteidiger lässt sich ein Teil dieser Unwägbarkeiten durch die Möglichkeit der Bestellung als „Pflichtverteidiger“ auffangen.
Teil 1 Das Mandat des Strafverteidigers› I. Der Wahlverteidiger› 2. Berufsrechtliche Pflichten bei der Mandatsübernahme
2. Berufsrechtliche Pflichten bei der Mandatsübernahme
9
Falls der zukünftige Mandant bereits von einem Wahlverteidiger vertreten wird und der Verteidiger dennoch das ihm angetragene Mandat annehmen will, hat er § 15 BORA zu beachten. Will der Mandant das Mandatsverhältnis zu dem früheren Verteidiger beenden, muss der neue Verteidiger nach § 15 Abs. 1 BORA sicherstellen, dass der früher tätige Rechtsanwalt unverzüglich von der Mandatsübernahme benachrichtigt wird. Soll der neue Verteidiger nicht anstelle des früheren, sondern neben diesem die Verteidigung führen, hat er ihn unverzüglich über die Mandatsmitübernahme zu unterrichten, § 15 Abs. 2 BORA.
Teil 1 Das Mandat des Strafverteidigers› I. Der Wahlverteidiger› 3. Die Vollmacht
10
Die Wirksamkeit der Beauftragung des Verteidigers ist nicht von der Erteilung einer schriftlichen Vollmacht abhängig. Insbesondere dürfen Staatsanwaltschaft und Gericht die Gewährung von Akteneinsicht nicht mit der Begründung versagen, dass sich der Verteidiger nicht durch eine schriftliche Verteidigervollmacht legitimiert habe. Eine besondere Form für die Beauftragung eines Wahlverteidigers sieht das Gesetz nämlich nicht vor. Sie erfolgt in aller Regel mündlich durch Erteilung eines Auftrages zur Verteidigung durch den Mandanten und Annahme des Mandates durch den Verteidiger. Damit ist die Verteidigerbestellung wirksam. Der Verteidiger kann nunmehr alle Verteidigungshandlungen vornehmen, soweit das Gesetz nicht ausnahmsweise eine schriftliche Vertretungsvollmacht verlangt.[4] Für den Nachweis des Verteidigerverhältnisses genügt die Anzeige des Verteidigers. Im Regelfall spricht die Vermutung für die Bevollmächtigung des Verteidigers, wenn sich dieser für den Beschuldigten zu den Akten meldet.[5]
11
Entschließt sich der Verteidiger, das Mandat anzunehmen, sollte er sich dennoch eine schriftliche Vollmacht erteilen lassen. Von ausschlaggebender Bedeutung für eine effektive und sachgerechte Verteidigung bereits im Ermittlungsverfahren ist nämlich eine schnellstmögliche Akteneinsicht. Nur diese stellt die für eine sachgerechte Verteidigung erforderliche „Parität des Wissens“ her. Da es trotz der eindeutigen Rechtslage noch immer Gerichte gibt, die rechtswidrig die Gewährung der Akteneinsicht von der Einreichung einer schriftlichen Verteidigervollmacht abhängig machen wollen, sollte der Verteidiger, um Zeit und unnötige Arbeit zu sparen, bereits dem Bestellschreiben eine schriftliche Vollmacht beifügen.
12
Die Verwendung der vom Fachbuchhandel herausgegebenen Vollmachtsformulare ist nicht zu empfehlen. Diese enthalten bspw. einen Passus, mit welchem der Verteidiger auch zur Empfangnahme von Ladungen ermächtigt wird (§ 145a Abs. 2 S. 1 StPO). Eine solche Ermächtigung birgt jedoch nicht unerhebliche Haftungsrisiken für den Verteidiger in sich. So muss der derart ermächtigte Verteidiger dafür sorgen, dass der Mandant nach der Einlegung des Einspruches gegen einen Strafbefehl oder einer Berufung Kenntnis vom Einspruchstermin oder vom Termin zur Berufungshauptverhandlung erhält. Bei dem Nichterscheinen des Mandanten werden Einspruch oder Berufung ohne Verhandlung zur Sache verworfen (§§ 412 S. 1, 329 Abs. 1 S. 1 StPO).
Читать дальше