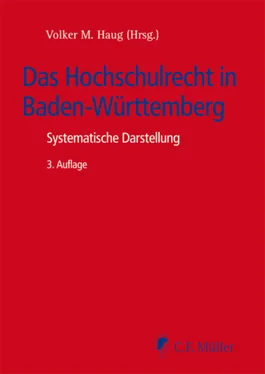[1]
Auf die Nennung der Parallelnormen in den anderen Hochschulgesetzen wird bei allen alten UG-Zitatstellen in dieser Einführung zur besseren Lesbarkeit verzichtet.
[2]
Diese Entwicklung ist jedoch angesichts jüngerer Entwicklungen infrage zu stellen. Dies gilt zunächst für die verschiedenen „Zulagenaffären“, die – trotz der dem Ministerium vorzuwerfenden Defizite in der Ausübung der Rechtsaufsicht – strukturelle Überforderungssymptome darstellen. Deutlich verschärfend tritt noch hinzu, dass das HRWeitEG von 2018 in Umsetzung von Vorgaben des VerfGH BW (Urt. v. 14.11.2016 – Az. 1 VB 16/15) der Professorenschaft eine beherrschende Stellung bei Wahl und Abwahl von hauptamtlichen Rektoratsmitgliedern eingeräumt hat, wodurch es eine strukturimmanente Frage ist, ob ein dergestalt vom professoralen Wohlwollen abhängendes Rektorat wirklich noch unabhängig über Gehälter ebendieser Professorenschaft entscheiden kann.
[3]
Kimminich , in: v. Münch, Besonderes Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 1988, S. 852, spricht davon, dass die „deutschen Universitäten […] zwar bereits im 19. Jh. die geistige Freiheit vom Staat erlangt [hatten], nicht jedoch die finanzielle Freiheit“. Bachof wird bei Kimminich, a.a.O., S. 858, noch deutlicher: „Die Beschränkung staatlicher Aufsichtsbefugnisse in akademischen Angelegenheiten wird weitgehend unterlaufen durch die Abhängigkeit der Hochschulen von staatlicher Finanzierung, mittels derer sich nahezu alle Hochschulbereiche umfassend steuern lassen.“
[4]
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/150109_Hochschulfinanzierungsvertrag.pdf(12.1.2019).
[5]
GBl. 1993, S. 209.
[6]
BVerfGE 147, 253 (Ls. 5, 1. Spiegelstrich).
[7]
Der Koalitionsvertrag von Bündnis90/Die Grünen und SPD („Der Wechsel beginnt.“, S. 12) sah vor, die Hochschulräte abzuschaffen und an ihrer Stelle extern besetzte Beiräte mit rein beratender Funktion zu installieren.
[8]
Näher dazu Sandberger , Paradigmenwechsel, VBlBW 2014, 321 ff.
[9]
Bis 1999 war zwar alternativ eine monokratische Präsidialverfassung möglich, wovon aber nur wenig Gebrauch gemacht wurde (vgl. Herberger in der 1. Aufl. dieses Buches, Rn. 226).
[10]
Die vierjährige Amtsperiode galt erst ab 1995; zuvor sah das Gesetz eine zwei- bis vierjährige Periode vor, wobei in aller Regel an der Mindestdauer festgehalten wurde, vgl. § 15 II UG 1992/95.
[11]
Damit hat das Rektorat auch alle wesentlichen Aufgaben des an den Universitäten bis 1999 bestandenen Verwaltungsrats übernommen. Diesem gehörten neben dem Rektorat als Amtsmitglieder vier Professoren sowie je ein Vertreter der drei übrigen Gruppen als Wahlmitglieder an (§ 20 IV UG). Hier wurde über die Aufstellung des Haushaltsplans, über die Verteilung von Stellen, Mitteln und Räumen und über die bauliche Entwicklung – und damit über die zentralen Steuerungsfragen der Universität als Organisation – beraten und entschieden (§ 20 II UG). Es ist nicht viel Phantasie vonnöten sich vorzustellen, dass der Verwaltungsrat das zentrale Machtzentrum der Universität darstellte. Zugleich bot dieses Gremium dem Rektor und dem Rektorat eine rege genutzte „Blitzableiterfunktion“, unpopuläre Entscheidungen dem Verwaltungsrat zuordnen zu können. Die Verantwortung für Führungsentscheidungen wurde so im Kollegialorgan verteilt, wodurch individuelle Verantwortung wesentlich weniger deutlich wurde und eingefordert werden konnte. Vielleicht ist das ein Grund, warum der Verwaltungsrat als Instrument bei den Universitätsleitungen so überaus populär war.
[12]
Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Professionalisierung von Leitungsstrukturen hatte das BVerfG festgestellt: „Die Stärkung von Kompetenzen der monokratischen Leitungsorgane […] führt nicht zu einer strukturellen Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit. Aus Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG folgt für die Verfassung der Selbstverwaltung von Hochschulen kein Vorrang von Kollegialorganen gegenüber monokratischen Leitungsorganen.“ (E 111, 333, 356). Die Grenze zur Verfassungswidrigkeit sah das Gericht erst bei der Möglichkeit einer strukturellen Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit als überschritten an (BVerfGE 111, 333, 357).
[13]
Bis 1995 brachte das Gesetz dies uneingeschränkt zum Ausdruck („entscheidet über alle Angelegenheiten der Universität, soweit sie nicht […]“); ab 1995 war der Senat auf „Angelegenheiten von Forschung, Lehre und Studium, die von grundsätzlicher Bedeutung und nicht […] einem anderen Organ […] übertragen sind“, – mithin auf die akademischen Angelegenheiten – beschränkt (jeweils § 19 I UG). Praktisch hatte die Einschränkung aber keine Auswirkungen, weil die Personal- und Wirtschaftsangelegenheiten ohnehin beim Verwaltungsrat lagen.
[14]
Zunächst (bis 2004) sah der Hochschulrat eine Mehrheit der internen Mitglieder vor und war an der Rektor- und Kanzlerwahl weniger stark beteiligt (§ 18 UG i.d.F. von 2000).
[15]
Krit. zu den weit reichenden Entscheidungsbefugnissen des Hochschulrates Kersten , Hochschulräte, DVBl. 1999, 1704 ff., der daraus einen Verstoß gegen Art. 5 Abs. 3 GG und gegen das Demokratiegebot ableitet; ebenso i.E. Krausnick , Staat und Hochschule, S. 398 ff.
[16]
Die Einflussnahme Externer ist besonders stark als Verletzung von Art. 5 III GG verfassungsrechtlich angegriffen worden. Das BVerfG hat jedoch in seiner Brandenburg-Entscheidung dazu angemerkt (E 111, 333, 356): „Die zur Sicherung der Wissenschaftsadäquanz von hochschulorganisatorischen Entscheidungen gebotene Teilhabe der wissenschaftlich Tätigen muss nicht in jedem Fall im Sinne der herkömmlichen Selbstverwaltung erfolgen. Auch hochschulexterne Institutionen können dazu beitragen, einerseits staatliche Steuerung wissenschaftsfreiheitssichernd zu begrenzen und andererseits der Gefahr der Verfestigung von status quo-Interessen bei reiner Selbstverwaltung zu begegnen.“; umfassend krit. zu dieser Entscheidung etwa Krausnick , Staat und Hochschule, S. 104 ff., 418 ff.
[17]
Die geringe Wertschätzung und die völlig fehlende Machtfülle des Amts des Dekans war besonders eindrucksvoll an dem Indiz zu erkennen, dass auch Professoren der Besoldungsgruppe C 3 dafür wählbar waren, während als Geschäftsführender Direktor eines Instituts – das hierarchisch ja unterhalb der Fakultätsebene stand – regelmäßig nur C-4-Professoren zugelassen waren (§ 28 VII UG).
[18]
Genauer: Eigentlich betrug die Amtszeit bis 1995 ein bis zwei Jahre nach Maßgabe der Grundordnung (§ 24 IV UG 1992), aber von der Verlängerungsoption wurde kaum Gebrauch gemacht. Danach sah das Gesetz eine zwei- bis vierjährige Amtszeit nach Maßgabe der Grundordnung vor (§ 24 IV UG 1995), mit demselben Effekt.
[19]
Nach § 8 II LVVO steht den Mitgliedern eines universitären Fakultätsvorstandes eine Deputatsermäßigung in Höhe von 14 SWS zu; dabei kann die Lehrverpflichtung des Studiendekans um höchstens 6 SWS und des Prodekans um 4 SWS reduziert werden. Daraus folgt für den Dekan eine Reduzierung von mindestens 4 SWS, die bis zur vollen Lehrverpflichtung reichen kann.
[20]
Den früheren „erweiterten Fakultätsrat“ gibt es nur noch als alternative Option zum Fakultätsrat als sog. „Großer Fakultätsrat“ (§ 25 III LHG).
[21]
Mit Inkrafttreten des LHG 2005 wurden keine neuen Diplom- oder Magisterstudiengänge eingerichtet; spätestens ab dem WS 2008/09 durften keine Studienanfänger mehr in solche Studiengänge aufgenommen werden (§ 29 III LHG 2005).
[22]
Zu diesem Modell im Detail Haug , Bildungsguthabenmodell, WissR 1998, 1.
[23]
Näher zum baden-württembergischen Studiengebührenmodell s. Faisst , 1. Aufl., Rn. 1197 ff.
Читать дальше