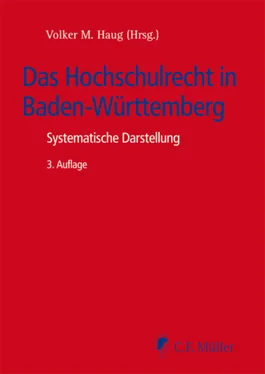41
Dennoch sind die Länder nicht völlig frei in der Ausgestaltung des Hochschulwesens. Wie in viele andere Bereiche dringt das Europarecht auch in dieses Tätigkeitsfeld vor, während das Völkerrecht sich eher zurück hält (A). Daneben sind – auch nach der Föderalismusreform von 2006 und in letzter Zeit als Gegenbewegung wieder zunehmend –Bundeskompetenzen bzw. -finanzierungen und natürlich nicht zuletzt die grundrechtlichen Vorgaben zu beachten (B). Schließlich zwingen schon rein praktische Erwägungen zur Koordination mit anderen Ländern und dem Bund (C). Das vorliegende Kapitel möchte insoweit eine Orientierung geben. Abgerundet wird es durch Ausführungen zu den in der Landesverfassung Baden-Württembergs enthaltenen Rahmenbedingungen und generell zum Landesrecht (D).
1. Kapitel Rechtsgrundlagen für die Hochschulen in Baden-Württemberg› A. Europarecht und Völkerrecht
A. Europarecht und Völkerrecht
42
Nach dem den Römischen Verträgen zu Grunde liegenden funktionellen Ansatz der wirtschaftlichen Integration i.V.m. dem Grundsatz der begrenzten (Einzel-)Ermächtigung[3] besteht zunächst einmal keine Kulturkompetenz der Union und auch nur eine teilweise Zuständigkeit für das Bildungs- und speziell das Hochschulwesen. Dennoch greift (und griff auch schon von Anbeginn an) ein solcher restriktiver Ansatz zu kurz. So enthielt der EWG-Vertrag schon ursprünglich eine Zuständigkeit für die berufliche Bildung (unter die die Hochschulausbildung mitunter subsumiert wurde; Art. 150 EGV, jetzt 166 AEUV). Art. 47 EGV (jetzt 53 AEUV) enthielt eine Zuständigkeit für die Anerkennung der Hochschulabschlüsse. Außerdem vertrat und vertritt der EuGH in ständiger Rechtsprechung die Auffassung, dass allgemeine Regeln des Vertrags (z.B. die Grundfreiheiten, das Diskriminierungsverbot) auch auf Bereiche ausstrahlen, in denen keine Regelungskompetenz der Union besteht.[4]
43
Zum andern wirkt sich das Hochschulwesen unbestreitbar auf das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes aus, so dass über Art. 114 und 115 dem Grunde nach eine Rechtsangleichungskompetenz eröffnetsein kann. Es ist einsichtig, dass z.B. der Zugang (der Arbeitnehmerkinder) zur Hochschulbildung für die Ausübung der Freizügigkeit durch ihre Eltern von Bedeutung ist. Ebenso steht außer Zweifel, dass Vergleichbarkeit und gegenseitige Anerkennung von Hochschulabschlüssen eine wesentliche Voraussetzung für die Ausübung von Grundfreiheiten(Freizügigkeit, Niederlassung, Erbringung von Dienstleistungen) ist.[5] Eine gemeinsame Forschungspolitik schließlich ist eine fast zwangsläufige Voraussetzung für das technologische Schritt halten des Gemeinsamen Marktes mit seinen Konkurrenten weltweit.
44
Vor diesem Hintergrund hat die Union seit Anbeginn vielfältige Aktivitätenentfaltet. Die verschiedenen Vertragserweiterungen haben ihre ausdrücklichen Kompetenzen zudem schrittweise erweitert (Forschungspolitik durch die Einheitliche Europäische Akte (EEA), jetzt Art. 179 ff. AEUV; Bildungspolitik Art. 149, 150 seit dem Maastricht-Vertrag, jetzt Art. 165, 166 AEUV). Zunächst fasste sie Entschließungen, legte Aktions- und Förderprogramme auf, errichtete einen Ausschuss für Bildungsfragen etc. Von besonderer Bedeutung waren die Diplomanerkennungs-RL von 1989[6] und die Berufsanerkennungsrichtlinie[7] von 2005, darüber hinaus die Aktivitäten im Rahmen des sog. Bologna-Prozesses zur Harmonisierung und Qualitätsverbesserung der Hochschulausbildung[8] und die Schaffung eines Europäischen Hochschulraumes. Im Forschungsbereich haben nunmehr sieben Forschungsrahmenprogrammeund seit 2014 das Programm Horizon 2020 erheblich zur Verbesserung der Forschungslandschaft beigetragen.[9] Eine gewisse Tendenz zur Ausweitung dieser Aktivitäten auf Themen der allgemeinen Bildung war in der Vergangenheit aber auch spürbar.[10]
45
Aus dem völkerrechtlichen Umfeldzu nennen sind insbesondere die Europaratskonventionen zur Mobilität von Studenten und Wissenschaftlern,[11] die Vorgaben der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und der Europäischen Sozialcharta sowie der Internationale Pakt vom 19. Dezember 1966 über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Nicht im rechtlich-verbindlichen Sinne aber doch von großer Bedeutung für die praktische Politik sind darüber hinaus die Aktivitäten der OECD, die im Rahmen von Berichten, Analysen, Benchmarks u.a. den Staaten bildungspolitisch „den Spiegel vorhält“ und sie somit faktisch zu Aktivitäten zwingt.[12]
1. Kapitel Rechtsgrundlagen für die Hochschulen in Baden-Württemberg› A. Europarecht und Völkerrecht › I. Rang und Wirkung von Europa- und Völkerrecht
I. Rang und Wirkung von Europa- und Völkerrecht
46
Sowohl das Primärrecht (insbesondere die Gründungsverträge) wie das Sekundärrecht (Verordnungen, teilweise Richtlinien) der EU genießen unmittelbare Wirkung[13] sowie Anwendungsvorrang[14] vor allem nationalen Recht, einschließlich der Verfassungen, also in Deutschland auch vor dem Grundgesetz und den Landesverfassungen. Seit den grundlegenden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Maastricht-Vertrag[15] und zur Bananenmarktordnung[16] steht fest, dass das Gericht bis auf weiteres eine Vereinbarkeit europäischen Rechts mit dem Grundgesetz nicht prüfen wird, so lange und soweit die Europäische Union insgesamt einen Standard von Grundrechten und weiteren Verfassungsgewährleistungen (z.B. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit) einhält, der dem des Grundgesetzes entspricht. Anderenfalls wäre die Übertragung von Hoheitsbefugnissen nach Art. 23 i.V.m. 79 III GG nicht (mehr) zulässig und die Mitgliedschaft der Bundesrepublik generell in Frage zu stellen.
47
Unionsrecht, welches nicht vom Zustimmungsgesetz gedeckt, also ultra vires ist, kann diese Vorrangwirkung freilich nicht beanspruchen, jedoch ist auch hierbei zu beachten, dass der EuGH selbst zunächst die Kompetenz der Union zum Erlass des Rechtsaktes prüft. Bei schwer wiegenden Verstößen gegen den Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung freilich dürfte auch eine Nichtberücksichtigung trotz eines entgegen stehenden Urteils des EuGH zulässig sein,[17] desgleichen bei denkbaren Verstößen gegen die Identität des Grundgesetzes.[18]
48
Darüber hinaus sind die Mitgliedstaaten über Art. 4 III EUV verpflichtet, die Durchführung gemeinsamer Politiken und allgemein das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes nicht zu behindern, sondern im Gegenteil aktiv zu einem Erfolg des Integrationsprozesses beizutragen.[19] Dies beinhaltet auch jenseits der Rechtsangleichung die konstruktive Teilnahme an europäischen Maßnahmen und Programmen. So müssen sie Interessierten die Teilnahme an Unionsprogrammen (z.B. Forschungsrahmenprogramm) ermöglichen, die erforderlichen Strukturen schaffen und ggf. Kosten tragen.
49
Die genannten Verpflichtungen treffen im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs auch die Länder sowie sonstige Einrichtungen, die hoheitlich handeln (also auch Gerichte, Körperschaften, insbesondere auch Hochschulen). Werden sie nicht eingehalten, macht sich der Mitgliedstaat Bundesrepublik einer Vertragsverletzungschuldig,[20] was erhebliche Sanktionen aber auch Schadensersatzforderungen der Bürger[21] nach sich ziehen kann. Nach den Vereinbarungen zur Föderalismusreform von 2006 belasten evtl. Strafzahlungen und Schadensersatzleistungen schwerpunktmäßig das verursachende Land[22] (auch wenn es selbst gar keine Handlungsmöglichkeiten hat wie z.B. bei der Entscheidung eines unabhängigen Gerichts).
Читать дальше