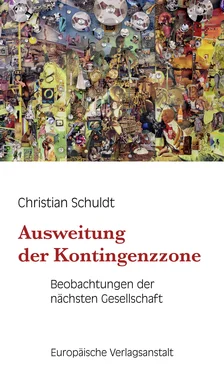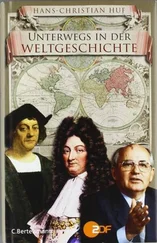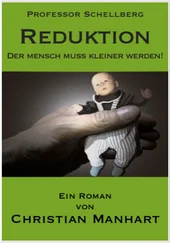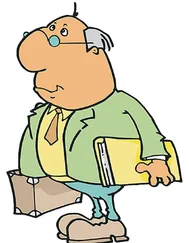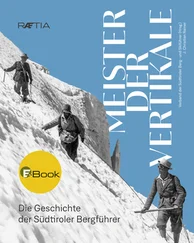Stattdessen betrachtet Luhmann Evolution aus der Perspektive selbstreferenzieller, autopoietischer Systeme – also Systeme, die sich aus ihren Elementen selbst erzeugen oder ermöglichen – und verabschiedet damit das Darwinsche Prinzip der „natürlichen Selektion“ durch die Umwelt. Stellt man die Evolutionstheorie auf die Co-Evolution strukturell gekoppelter, selbstreferenziell-geschlossener Systeme um, gibt es auch keine Garantie für Stabilität mehr – vielmehr „müssen diese Systeme selbst für ihre Stabilität sorgen, um weiterhin an Evolution teilnehmen zu können“ (ebd., 427). An die Stelle der Stabilität tritt das Prinzip der Restabilisierung, das gewissermaßen „nachgeschaltet“ ist und nur zum Einsatz kommt, „wenn Variation und Selektion ‚zufällig‘ zusammenwirken“ (ebd.).
Hier wird bereits die grundlegende Kontingenz gesellschaftlicher Wandlungsprozesse deutlich. Restabilisierung ist als dritter Faktor zugleich Voraussetzung und Ende einer evolutionären Sequenz – und führt daher nicht zu Anpassung, sondern, im Gegenteil, zu einer Abweichungsverstärkung: „Die unbeabsichtigt oder jedenfalls unbezweckt erzeugten Auswirkungen auf die Umwelt scheinen zu explodieren“ (ebd., 133). In diesem Sinne ist eine „postdarwinistische“ Evolutionstheorie eine „ökologische“ Theorie: Ihr erscheint Wandel weniger notwendig als kontingent.
Eine solche Perspektive auf Evolution verbindet den historischen Rückbezug mit Zukunftsoffenheit, ausgehend von einer Vielzahl koexistierender Alternativen sowie nichtarbiträrer Verbindungen zwischen dem, was ist, und dem, was war. Weil Evolution demnach ein dynamischer Prozess der kontinuierlichen Neuerfindung ist, bei dem der Faktor Umwelt eine entscheidende Rolle spielt, werden die modernistischen Konzepte von Intentionalität, Planung und freiem Willen gleichsam obsolet. So wie ein Ökosystem kein Zentrum hat, folgt Evolution keinen Richtlinien, die systemisch vorgegeben werden. Und natürlich spielt auch der Mensch keine übergeordnete Rolle, sondern fungiert als ein Element unter vielen innerhalb hochkomplex-verschränkter Systemumwelten.
Dieser evolutionäre Paradigmenwechsel gleicht der Umstellung von einer Kybernetik erster Ordnung auf eine Kybernetik zweiter Ordnung: von steuerbaren Systemen hin zu autopoietischen Systemen, bei denen sich Input und Output wechselseitig bedingen, verbunden durch Feedback-Loops. Beispiele für solche „immanenten“ Systeme sind biologische Organismen, das Bewusstsein, das Klima und auch die Gesellschaft selbst.
Den roten Faden eines systemtheoretischen Evolutionsverständnisses bildet eine Paradoxie: die Wahrscheinlichkeit des Unwahrscheinlichen. „Die Unwahrscheinlichkeit des Überlebens isolierter Individuen oder auch isolierter Familien wird transformiert in die (geringere) Unwahrscheinlichkeit ihrer strukturellen Koordination, und damit beginnt die soziokulturelle Evolution “ (Luhmann 1997, 414). Die evolutionäre Leitfrage lautet deshalb: Wie ist es möglich, dass immer unwahrscheinlichere Strukturen entstehen und als Normalität funktionieren? Die Antwort der Systemtheorie lautet: durch die evolutionäre Umwandlung von „geringer Entstehungswahrscheinlichkeit in hohe Erhaltungswahrscheinlichkeit“ (ebd.).
Die nächste Gesellschaft, die Netzwerkgesellschaft, bildet die bislang unwahrscheinlichste Stufe der soziokulturellen Evolution – und stellt zugleich einen Epochenbruch dar, der so einschneidend ist wie der Übergang zur Sesshaftigkeit oder die industrielle Revolution. Dabei ist die digitale Transformation zugleich eine bewegliche Epochenschwelle, die strukturell, kulturell und intellektuell auf verschiedene Zeitpunkte fixierbar ist – so wie sich das Paradigma der Elektrizität erstreckt vom Beginn der urbanen und industriellen Elektrifizierung Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Einführung und Etablierung des Computers mit seinen Netzwerken, Speichern und Algorithmen im 20. und 21. Jahrhundert.
Viel entscheidender als eine zeitliche Fixierung ist jedoch das Prinzip der evolutionären Temporalisierung, das prägend ist für die strukturelle Koordination dieser neuen Komplexität. Dirk Baecker beschreibt es als oszillierendes Zusammenspiel von Zerfall und Wiederaufbau beziehungsweise Entropie und Negentropie: „Die Zeit der nächsten Gesellschaft ist nicht mehr die der ewigen Wiederkehr noch die eines sich erfüllenden Schicksals oder gar des Fortschritts. Stattdessen handelt es sich um eine Zeit des Zerfalls, der Entropie, als Voraussetzung des Aufbaus einer vorübergehenden Ordnung, einer Negentropie“ (Baecker 2018a, 76).
Beides, Entropie und Negentropie, bedingt einander: Der Zerfall ist die Voraussetzung für den Wiederaufbau – weil er die Form ist, die verschiedenste Zeitlichkeiten zumindest momentweise synchronisieren kann. Genau darin liegt der evolutionäre Geschwindigkeitsvorteil der elektronischen Medien, die unser Sozialverhalten unweigerlich begleiten und beeinflussen. Sie können „an jeder Schnittstelle genau die Zerfallsfrequenzen anbieten, die Körper, Gehirn, Interaktion unterschiedlich attrahieren und für den Moment binden“ (ebd., 84). Das Resultat dieser Verknüpfung des Heterogenen und nur kontextuell Zugehörigen ist eine umfassende Dynamisierung und Flexibilisierung der gesellschaftlichen Grundstrukturen – eine unkontrollierbare, „unordentliche“ Gesellschaft.
Sinnüberschuss: Die unordentliche Gesellschaft
Die nächste Gesellschaft ersetzt das Strukturprinzip der klar separierten Funktionssysteme, das die moderne Gesellschaft dominiert hat, durch das neue Paradigma des Netzwerks. An die Stelle der funktionalen Rationalität und der Vernunft, die noch die moderne Gesellschaft mit ihren klar abgrenzbaren Subsystemen dominierten, tritt die neue Strukturform des Netzwerks. Es ist gekennzeichnet durch die hybride Kopplung heterogener Elemente, hat keine spezifischen Grenzen, ist jederzeit irritierbar und verknüpfbar. Heterogene Varianzen lösen die moderne Dynamik ab.
In diesem Sinne funktioniert die digitale Transformation rekursiv und nicht-trivial: Indem sie ständig neue Voraussetzungen für Anschlusskommunikationen schafft, die wiederum neue Voraussetzungen für weitere Anschlusskommunikationen schaffen, wird die soziale Realität gewissermaßen „verflüssigt“ (vgl. Bauman 2000). Damit endet gleichsam die Ära des Atoms, das als Leitmotiv für einen „autoritären“ Individualismus stand: nach innen hierarchisch strukturiert, nach außen in Relationen zu anderen Elementen, aber dennoch solitär. Die Metapher für das 21. Jahrhundert ist dagegen das dynamische Netz, das Prinzip der Interdependenz der Gleichen. Es geht um die kooperative Wechselseitigkeit von Strukturen und Individuen, die sich gegenseitig brauchen und bedingen, um das Gesetz der strukturellen Äquivalenz. Eben deshalb unterscheidet sich die nächste Gesellschaft von der modernen Gesellschaft „wie die Elektrizität von der Mechanik“ (Baecker 2018a, 14).
Je mehr das alte Prinzip der Verbreitung, das die Ära des Buchdrucks prägte, abgelöst wird vom neuen Prinzip der computerisierten Resonanzen, umso mehr wird auch das individualistische Selbstbild der Moderne obsolet. Immer weniger geht es um die individuellen Motive individueller Handlungen – und immer mehr um Singularitäten und Aktivitäten, die einander bedingen und rekrutieren. Auch Identitäten können in der Netzwerkgesellschaft nur noch in Abhängigkeit von anderen Netzwerkelementen bestimmt werden.
Um tiefer zu verstehen, wie diese nächste Gesellschaft alte Strukturen flexibilisiert und verabschiedet, hilft ein Blick auf die Historie der Gesellschaft. Wie bereits in der Einleitung umrissen (siehe S. 14ff.), lässt sich die Evolution der Gesellschaft in vier Epochen unterteilen (tribale Gesellschaft, antike Gesellschaft, moderne Gesellschaft, Netzwerkgesellschaft), die ihrerseits mit vier dominanten Verbreitungsmedien verbunden sind (Sprache, Schrift, Buchdruck, Computer). Neue Verbreitungsmedien prägen aber nicht nur die Art, wie Inhalte verbreitet werden, sondern auch die Basisstruktur der Kommunikation, die Grundlage jeder Gesellschaft. Wird die Kommunikation komplexer, weil auf einmal mit Büchern neue Ideen verbreitet werden können oder weil über das Internet unmittelbare Vernetzung im großen Stil stattfinden kann, entstehen neue Gesellschaftsformen.
Читать дальше