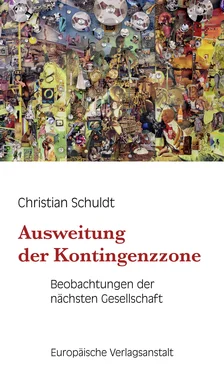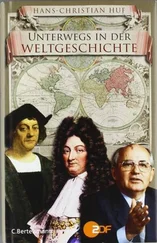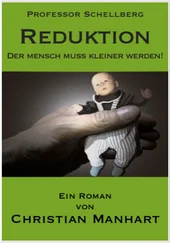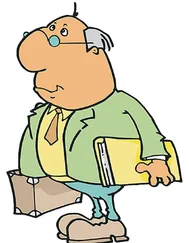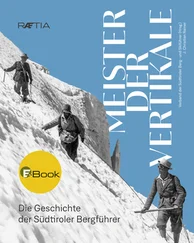An der Grenze zwischen System und Umwelt herrscht also immer ein Komplexitätsgefälle: Die Umwelt ist stets komplexer als das System, und das System ist stets „geordneter“ als seine Umwelt. Um aber Komplexität reduzieren zu können, müssen Systeme zunächst selbst über Komplexität verfügen. Erst ein gewisses Maß an Eigenkomplexität erlaubt es ihnen, auf Veränderungen in ihrer Umwelt zu reagieren und den eigenen Fortbestand dynamisch zu sichern – und je komplexer ein System ist, desto mehr Reaktionsmöglichkeiten hat es. Soziale Systeme verfügen damit über eine dynamische Stabilität.
Auf Basis dieser dynamischen Stabilität sozialer Systeme vollzieht sich die gesellschaftliche Evolution – denn „nur die Differenz von System und Umwelt ermöglicht Evolution“ (Luhmann 1997, 433). In diesem Prozess bilden sich Strukturen heraus, mit denen die Unwahrscheinlichkeit gelingender Kommunikation wahrscheinlich gemacht wird. Auf Basis des Angepasstseins können dann immer radikalere Unangepasstheiten entstehen, Unwahrscheinliches kann immer schneller wahrscheinlich werden. Das Resultat ist „eine ungewöhnlich hohe, in der Lebenszeit der einzelnen Menschen sichtbar werdende Änderungsfrequenz in den Strukturen des Gesellschaftssystems“ (ebd., 495).
Alle evolutionären Errungenschaften gleichen sich deshalb darin, dass sie kombinatorische Möglichkeiten erhöhen, also höhere Komplexitätsgrade ermöglichen. Die vier Formen gesellschaftlicher Differenzierung, die die gesellschaftliche Evolution auf dieser Grundlage hervorgebracht hat, sind daher auch gestaffelt nach ihrer ansteigenden Komplexität:
•segmentäre Differenzierung (tribale/archaische Gesellschaft)
•stratifikatorische Differenzierung (antike/traditionelle Gesellschaft)
•funktionale Differenzierung (moderne Gesellschaft)
•vernetzte Differenzierung (Netzwerkgesellschaft)
Jede dieser Gesellschaftsformen ist direkt verbunden mit einem dominanten Verbreitungsmedium – Sprache, Schrift, Buchdruck, Computer –, das jeweils einen kommunikativen „Sinnüberschuss“ produziert. Das heißt: Jede einzelne Kommunikation kann und muss verglichen werden mit den sozialen Phänomenen, die durch die mediale Verbreitung ebenfalls in den Blick kommen. Die Gesellschaft reagiert auf diesen medialen Sinnüberschuss mit Strukturformen, die die Verteilung der jeweiligen Kommunikationsmöglichkeiten akzeptabel machen, und mit Kulturformen, die bestimmte soziale Phänomene in der Differenz zu anderen definieren. „Gelöst“ werden kann das Problem des Sinnüberschusses also nur durch neue Orientierungsmuster und Kulturformen beziehungsweise Semantiken (siehe III. Reflexion, S. 79).

Gesellschaft 1.0 bis 4.0: Evolution der Verbreitungsmedien sowie der Struktur- und Kulturformen
Die verschiedenen Medienepochen verdrängen sich nicht, sondern überlagern sich. Auch im Kontext der Vernetzung muss die Gesellschaft also neue und andere Lösungen finden für alle Probleme, die vorige Gesellschaften bereits gelöst haben. Die Netzwerkgesellschaft lässt sich deshalb nicht verstehen ohne ein Verständnis für die Dynamik früherer Gesellschaften.
Die nächste Gesellschaft: Vernetzte Komplexität
Seitdem die Strukturform der funktionalen Differenzierung Mitte des 19. Jahrhunderts tonangebend wurde, ist die Gesellschaft nach Typen von Kommunikationen differenziert. Diese Kommunikationen werden von den einzelnen Funktions- oder Subsystemen der Gesellschaft geleitet: Subsysteme wie Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Religion oder Kunst entscheiden in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet eigenmächtig, welche Kommunikationen aneinander anschließen. Mithilfe binärer Codierungen (etwa Zahlung/Nichtzahlung in der Wirtschaft oder Wahrheit/Unwahrheit in der Wissenschaft) und Erfolgsmedien (etwa Geld in der Wirtschaft oder Wahrheit in der Wissenschaft) sorgen sie auf je eigene Weise dafür, dass auch unwahrscheinliche Kommunikation wahrscheinlich wird.
Das Versprechen der Moderne lautete dabei, dass alle Funktionssysteme für alle Personen zugänglich sind – allerdings immer nur unter partikularen Personenmerkmalen, in bestimmten Rollen, etwa als Politikerin, Verkäufer, Wissenschaftlerin, Künstler oder Angestellter. Die Netzwerkgesellschaft, die nun im 21. Jahrhunderts zunehmend Form annimmt, weicht diese Prämisse auf: Die neue Differenzierungsform schafft in allen Gesellschaftsbereichen neue Schnittstellen, an denen sich neuartige soziale, kulturelle und technologische Phänomene kristallisieren. Mit der gesellschaftlichen Komplexität steigt auch die Kontingenz rapide an und bringt das moderne Inklusionsversprechen ins Wanken.
In der Netzwerkgesellschaft werden die „vernünftigen“, klar konturierten Ordnungen früherer Gesellschaften abgelöst durch eine offene Ökologie: durch die Komplexität überraschender und potenziell flüchtiger Ordnungen. Überall in der Gesellschaft werden traditionelle Grenzen, Strukturen und Hierarchien beweglich und fluide. Unter vernetzten Vorzeichen ist somit eigentlich nur noch eines gewiss: die Ungewissheit. Zum zentralen Bezugsproblem wird damit die Bewältigung von Komplexität – und die Anpassung an eine neue Dimension von Kontingenz.
Von Kausalität zu Kontingenz
Die Systemtheorie fokussiert auf die Entdeckung des Unwahrscheinlichen im Gewöhnlichen, auf die Transformation von Notwendigkeit in Kontingenz. Anders als das Gros der westlichen Philosophen, die meist von einer normativen, rationalen oder „natürlichen“ Grundlage für soziale Realität ausgingen, setzt Luhmann auf das kontingente Auch-anders-möglich-Sein – allerdings nicht als postmodernistisches „anything goes“, sondern als Theorie der Kontingenz.
„Kontingenz“, so Luhmann, „heißt praktisch Enttäuschungsgefahr und Notwendigkeit des Sicheinlassens auf Risiken“ (Luhmann 1987, 31), sie bezeichnet „Gegenstände im Horizont möglicher Abwandlungen“ (Luhmann 1984, 152): Nichts, was passiert, ist zwingend. Dies ist die logische Folgerung, wenn die alten mechanistischen Steuerungsideen abgelöst werden durch die wechselseitigen Feedbackeffekte komplexer System-Umwelt-Gefüge. Die Erkenntnis, dass Systeme immer nur verstehbar sind in ihren Umweltkontexten, verabschiedet die Idee klarer kausaler Zusammenhänge und Verbindungen. An die Stelle des Kontrollierbarkeitsglaubens tritt das Operieren mit Wahrscheinlichkeiten.
Unter den Bedingungen der Vernetzung erfordert diese neue kontingente Realität von allen Akteuren der Gesellschaft eine Öffnung für das Unplanbare und Unvorhersehbare, eine Flexibilisierung mentaler und organisationaler Muster und Strukturen. In der Praxis hat sich unsere soziale, emotionale und rationale Intelligenz bereits auf diese neue, fluide Realität eingestellt. Unser Denken und Fühlen jedoch folgt großenteils noch immer den Konzepten vorheriger Epochen, wie es der Soziologe und Luhmann-Schüler Dirk Baecker beschreibt:
„Wir haben es immer noch, wenn nicht zunehmend, mit der Topologie von Stimmen (tribale Gesellschaft 1.0), der Teleologie verschiedener Korporationen und Dynastien (antike Hochkultur 2.0) und der Rationalität unruhiger Funktionssysteme (moderne Gesellschaft 3.0) zu tun. Aber diesen überlagert sich die Komplexität einer neuen Verschaltung von Mensch und Maschine, Körper, Bewusstsein und Gesellschaft, die im Fadenkreuz analoger und digitaler Verrechnung eher freigesetzt als gezähmt wird (nächste Gesellschaft 4.0).“ (Baecker 2015a, S. 15)
Читать дальше