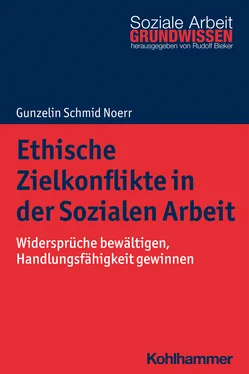1.4 Soziale und ethische Antinomien
Die Ethik bringt die möglichen Unterschiede und Widersprüche zwischen den moralischen Werten und Normen zur Sprache, die auf der Ebene der Moral selbst eher unmittelbar ausgefochten oder verdrängt werden. Sie verfolgt damit die Absicht der Klärung, Schlichtung und begründeten Orientierung. Moralische Werte und Normen sind immer auch Ausdruck einer Lebenswirklichkeit und der darin verankerten Ansichten, Bedürfnisse und Erwartungen. Da diese je nach individuellen und sozialen Bedingungen unterschiedlich, ja gegensätzlich sein können, kommt es auch zu entsprechend unterschiedlichen Werten und Normen.
Zur Zeit der Industrialisierung in der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es noch keine Sozialgesetzgebung, diese kam in Deutschland erst in den 1880er Jahren unter dem damaligen Reichskanzler Otto von Bismarck auf, während bis dahin sich vor allem die Kirchen um die Fürsorge von Armen und Kranken gekümmert hatten. Mit dem neuen Reichtum der Produzenten, Händler und Finanziers entstand um die industriellen Zentren herum auch massenhaft neue Armut. Bismarck wolle damit vor allem sozialen Unruhen, vielleicht gar einer Revolution des von Armut und Elend bedrohten Proletariats vorbeugen. Nach und nach wurden Nothilfen eingerichtet und die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter gegenüber den Fabrikanten reguliert. Noch einige Jahre zuvor hatte Karl Marx in seinem Hauptwerk Das Kapital (1867) über die Auseinandersetzungen um die Länge des Arbeitstages geschrieben:
»Der Kapitalist behauptet sein Recht als Käufer [der Arbeitskraft], wenn er den Arbeitstag so lang als möglich und womöglich aus einem Arbeitstag zwei zu machen sucht. […] der Arbeiter behauptet sein Recht als Verkäufer, wenn er den Arbeitstag auf eine bestimmte Normalgröße beschränken will. Es findet hier also eine Antinomie statt, Recht wider Recht, beide gleichmäßig durch das Gesetz des Warentausches besiegelt. Zwischen gleichen Rechten entscheidet die Gewalt.« (Marx [1867] 1968, 249)
Marx spricht von einer »Antinomie« (Unvereinbarkeit von Gesetzen), wobei er sich auf das ökonomische »Gesetz des Warentausches« bezieht, bei dem zwei Partner Waren tauschen, indem sie jeweils so viel wie möglich zu erlangen suchen, wofür sie so wenig wie nötig geben müssen. Unter Bedingungen der beiderseitigen Freiheit von Angebot und Nachfrage der Ware Arbeitskraft wird der Tausch bei einem einigermaßen gerechten Mittelwert erfolgen oder, wenn die Erwartungen zu weit auseinanderliegen, nicht zustande kommen. Nur gab es in der Realität der ungleichen Ausgangslagen diese Freiheit kaum. Deshalb spricht Marx hier von Gewalt als Mittel der Entscheidung über ökonomische Antinomien im Kampf der sozialen Klassen.
Der frühe Kapitalismus konnte sozialstaatlich ein Stück weit gebändigt, die Verelendung der Massen zurückgedrängt werden. Damit verschwanden freilich nicht die praktischen Antinomien. Die Interessengegensätze, Widersprüche in den Ansichten, Unterschiede in den sozialen Lagen blieben bestehen. Durch die Einbindung der arbeitenden Bevölkerung in die Industrie wurden die traditionellen Familien- und Verwandtschaftsstrukturen aufgelöst, und damit zerfielen auch die überkommenen Hilfestrukturen. An ihre Stelle trat nun die Soziale Arbeit, als Teil des Sozialstaatsregimes. Infolgedessen hatte auch sie es immer wieder mit der Bewältigung von praktischen Antinomien zu tun. Der ihr innewohnenden Ethik entsprechend, ersetzte sie reale oder drohende Gewaltverhältnisse durch Vereinbarungen.
Von dieser Herkunft zeugt die sie bis heute bestimmende Grund-Ambivalenz von Hilfe und Kontrolle. War ihr herrschaftlich vorwiegender Zweck die Kontrolle der aus den Kreisläufen der Normalität Herausgefallenen oder Ausgeschlossenen, so war doch dieses Ziel nachhaltig allenfalls dadurch zu erreichen, dass man ihnen Hilfe zuteilwerden ließ: Hilfe zur Versorgung der Grundbedürfnisse und zur Arbeitsfähigkeit. Unbedachte, naive Hilfe konnte aber auch zur Verstärkung der Abhängigkeit führen, wie beispielhaft im Falle eines Alkoholikers, der sich mit dem ihm zugesteckten Almosen wiederum Alkoholisches kauft. In der Abwehr solchen absehbaren Scheiterns von Hilfe konzipierte man Hilfe sozialpädagogisch als Hilfe zur Selbsthilfe. Hilfe sollte sich selbst überflüssig machen. Schon der Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1824) hatte mittels einer ganzheitlichen Bildung in Familie und Schule das Volk zu einem selbständigen und kooperativen Wirken in einem demokratischen Gemeinwesen befähigen wollen. Dieser Gedanke wurde in der Reformpädagogik wie auch in der Sozialen Arbeit weiterentwickelt. Aber auch er war nicht unberührt vom Aspekt der Kontrolle, unterschied man doch schon früh zwischen würdigen und unwürdigen Hilfsbedürftigen, wobei die ersteren sich als arbeitswillig, die letzteren als arbeitsunwillig zeigten.
Soziale Arbeit als Profession soll ihre Adressatinnen bei der Lösung von Problemen ihrer Lebensführung unterstützen. Ein »Beruf«, d. h. ein durch Ausbildung institutionalisiertes Wissen und Können, das gegen Bezahlung der Gesellschaft zur Verfügung steht, wird dadurch zu einer »Profession«, dass sich dieses Wissen und Können auf einen gesellschaftlich zentralen Wert bezieht und dass dies mithilfe von Institutionen wie Wissenschaft, Lehre, Prüfungen abgesichert wird. Im Fall der Sozialen Arbeit ist der entsprechende Terminalwert der der »Wohlfahrt«. Er kann auf zweierlei Wegen verwirklicht werden, einerseits negativ, durch Verhinderung derjenigen Umstände, die ihn gefährden, andererseits positiv, durch Verstärkung anderer Bedingungen, die ihn begünstigen. Kontrolle und Zwang gehören damit ebenso grundlegend zur Sozialen Arbeit wie Hilfe und Förderung, wenn auch ihr jeweiliges Mischungsverhältnis in den verschiedenen Arbeitsfeldern sehr unterschiedlich ist.
Die Lösung von Problemen der Lebensführung zielt darauf, das sonst als ›normal‹ geforderte Maß an Eigenverantwortung und Selbständigkeit zu erreichen. Dieses Ziel steht in einem unauflösbaren Spannungsverhältnis mit den gesellschaftlichen und natürlichen Bedingungen, die zu den Schwierigkeiten der Einzelnen wesentlich beitragen. Globale Veränderungen von Produktion, Handel und Finanzwirtschaft sowie die von Naturkatastrophen, Kriegen oder Flüchtlingsströmen ausgehenden kulturellen Verwerfungen lassen sich von den Individuen nicht oder kaum beeinflussen und schlagen doch auf ihre Lebensbedingungen durch. Betroffen sind diese allerdings in sehr unterschiedlichem Maße, je nachdem, über welche Ressourcen sie an ökonomischem, sozialem und kulturellem Kapital verfügen. Der Sozialen Arbeit wird dabei die Aufgabe zugewiesen, im individuellen Maßstab Probleme zu bearbeiten, die im gesellschaftlichen, ja globalen Maßstab verursacht wurden. Soziale Arbeit, die dies erkennt, intendiert sowohl Verhaltensänderung als auch (im beschränkten Maßstab) Verhältnisänderung, und kann doch nicht beides zugleich tun. In ihrer Praxis hat dies zur Folge, dass sie immer wieder Zielkonflikte bewältigen muss.
Die generelle praktische Zielvorstellung der Sozialen Arbeit besteht im Empowerment ihrer Klientel. Deren Selbstbestimmung wird vielfach durch physische und psychische Lebensbedingungen der Individuen verhindert. Das Leben unter materiell schwierigen Bedingungen, in gewaltaffinen Verhältnissen, mit Arbeits- oder Wohnungslosigkeit, mit körperlichen, psychischen oder mentalen Einschränkungen, mit Belastungen durch Krankheit und Alter, all dies verursacht bei den Betroffenen strukturelle Fremdbestimmungen. Sie sind deshalb auf besondere Rücksichten und Unterstützungen seitens der Sozialen Arbeit angewiesen, die aber nun ihrerseits allzu leicht in Fremdbestimmung umschlagen kann. Diese Fremdbestimmung muss nicht unbedingt durch fragwürdige Machtgelüste der Fachkräfte bedingt sein, sie kann auch dem Schutz der Klienten geschuldet sein. Jedenfalls stellen Selbst- und Fremdbestimmung ein zentrales Spannungsverhältnis der Sozialen Arbeit dar.
Читать дальше