1 ...8 9 10 12 13 14 ...18 Die Untersuchungen des vorliegenden Buches gehen weder von einer allgemeinen ethischen Theorie und ihren obersten Prinzipien (deren Wahl oft strittig bliebe) noch von den Prinzipien mittlerer Reichweite wie Nichtschaden, Wohltun oder Integrität aus. Vielmehr lassen sie sich von der sozialarbeiterischen Praxis typische Szenarien des jeweiligen Arbeitsalltags vorgeben, in denen professionsethische Fragen und Anforderungen sichtbar werden und als klärungsbedürftig erscheinen. Dabei wird deutlich, dass ethische Werte in ihrer konkreten Anwendung und Ausformung keineswegs immer ein harmonisches Ganzes bilden, sondern, wie man am Fall des Schüttelbabys (  Kap. 1.1) bereits erkennen konnte, zu widersprüchlichen Anforderungen führen können.
Kap. 1.1) bereits erkennen konnte, zu widersprüchlichen Anforderungen führen können.
Die in diesem Fall entscheidenden ethischen und zugleich rechtlichen Grundsätze, die wegen ihrer weitreichenden Bedeutung im sozialen Leben zugleich auch rechtlich kodifiziert sind, sind die des Kindeswohls und des Elternrechts. Während die große Bedeutung das Elternrechts sich darin äußert, dass es in das Grundgesetz aufgenommen wurde, gilt dies (bisher noch) nicht für das Kindeswohl. Doch ist die grundgesetzliche Festschreibung des Elternrechts untrennbar auch mit der Elternpflicht verbunden, für das Kindeswohl zu sorgen, wobei der Staat über die Einhaltung dieser Pflicht wacht.
Um diese Grundsätze professionsethisch zu wahren, sind im oben zitierten Ethikkodex des DBSH die Grundsätze »Wohlwollen« und »Nichtschaden« einschlägig. Diese beziehen sich unmittelbar auf das Verhalten der professionellen Kraft gegenüber der Klientel, nämlich dem Kind, was bedeutet, dass alle Maßnahmen dazu dienen sollen, eine Verschlechterung der Lage des Kindes zu vermeiden und sein Wohl zu vermehren. Wie dies hier zu erreichen wäre, kann konkret nicht angegeben werden, solange der Sachverhalt nicht hinreichend geklärt ist. Auch ist das Wohlergehen des Kindes im weiteren Sinn durchaus mit dem Wohlergehen der Eltern verbunden, die dadurch zum Adressaten nicht nur der Kontrolle, sondern auch der Hilfe durch die Soziale Arbeit aufrücken. Damit gerät die Soziale Arbeit erneut in einen Zielkonflikt.
Gut zu wissen – gut zu merken



Ethische Zielkonflikte sind in der Sozialen Arbeit allgegenwärtig. Das bedeutet, dass sich weder Ethik noch Moral als widerspruchsfreie Systeme darstellen lassen. Sie drücken die Orientierung an den berechtigten Interessen Anderer aus. Was als ›berechtigt‹ zu gelten hat, hängt auch von der konkreten Konstellation und ihrer jeweiligen Deutung ab. Deshalb kommt es gegebenenfalls zu ethischen Antinomien. Diese sind nicht abstrakt-allgemein zu benennen, sondern in einer Doppelbewegung vom Allgemeinen zum Besonderen und umgekehrt einzukreisen. Es genügt nicht, Antinomien nachzuzeichnen, vielmehr sind Wege aufzusuchen, die aus ihnen hinausführen.



Raters, Marie-Luise (2013): Das moralische Dilemma. Antinomie der praktischen Vernunft? Freiburg i. Br. und München: Alber.
Schweppenhäuser, Gerhard (2021): Grundbegriffe der Ethik. Ditzingen: Reclam.
Weston, Anthony (1999): Einladung zum ethischen Denken. Freiburg i. Br.: Herder.
2 Sich ethisch orientieren Allgemeine Ethik und Professionsethik



Was Sie in diesem Kapitel lernen können
Für viele Berufe, die unmittelbar mit Menschen zu tun haben – so auch für die Soziale Arbeit –, gibt es verantwortungsethische Leitlinien, die hier in ihrem Grundriss erklärt werden. Um sie konkret umzusetzen, muss man sich darüber klar sein, auf welche Form von Ethik man sich bezieht. Im Folgenden geht es um die Unterschiede
• zwischen deskriptiv-explanatorischer, normativer und kritischer Ethik,
• zwischen Individualethik und Sozialethik,
• zwischen Strebensethik und Sollensethik.
Welche ethischen Gesichtspunkte sind bei einer Entscheidungsfindung zu bedenken? Hier sind Motive, Ziele, Mittel und Folgen zu unterscheiden. Um sich zwischen konkurrierenden Werten zu orientieren, wird als sehr nützliches Instrumentarium das sogenannte »Wertequadrat« vorgestellt. Damit kann man Werte situativ profilieren und die gelegentlich notwendige Abwägung ausbalancieren.
2.1 Professionsethische Leitlinien
Die sozialarbeiterische Professionsethik fragt nach den Zielen, um derentwillen die Soziale Arbeit stattfindet, welche Funktion diese Profession hat, haben kann und haben soll. Die professionsethischen Selbstverpflichtungen der Fachkräfte stellen gleichsam Leitplanken dar, die verhindern sollen, in der Überschreitung der Intimität der Klienten nicht über das fachlich unabdingbare Maß hinauszugehen und das Wohlergehen der Klienten sowie das Allgemeinwohl als oberste Kriterien des eigenen Handelns anzusehen. Solche Leitlinien sind relativ allgemein (und müssen das auch sein, um auf alle möglichen Fälle anwendbar zu sein), aber wirksam werden sie erst dann, wenn sie in den jeweiligen fachlichen Kontexten konkretisiert werden. Nur so kann ihr innerer Zusammenhang mit den Grundstrukturen des sozialarbeiterischen Handelns deutlich werden.
Professionsspezifische Ethiken sind besonders dort formuliert worden, wo die vom professionellen Handeln Betroffenen in besonderem Maße diesem ausgeliefert sind. Diese Ethiken sollen das für die Tätigkeit notwendige Vertrauensverhältnis stützen, indem sie die das professionelle Handeln legitimierenden Werte und die es leitenden Normen beschreiben und analysieren. Um welche Grundsätze handelt es sich?
Die älteste formulierte Professionsethik ist bekanntlich die medizinische. Ihr Ursprung wird dem Arzt Hippokrates zugeschrieben, der im 5. Jahrhundert v. Chr. auf der griechischen Insel Kos lebte. Im sogenannten Hippokratischen Eid wurden Grundregeln des ärztlichen Handelns, Gebote und Verbote formuliert, die die Patientinnen vor Missbrauch der ärztlichen Kunstausübung schützen sollten, aber auch Verpflichtungen gegenüber den Kolleginnen und angrenzenden Berufen sowie gesellschaftlichen Erwartungen enthielten. Die heute bekannte Formulierung des Eides ist aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. überliefert und gehört einer vergangenen Kultur an. Heute gibt es entsprechend veränderte Formulierungen. (Das »Genfer Gelöbnis«: Wer heute approbiert ist, ist durch Zwangsmitgliedschaft in der Ärztekammer auf die Berufsordnung verpflichtet.) Der nach wie vor gültige medizinethische Grundgedanke besagt, dass die ärztlich Tätigen die körperlichen, psychischen und sozialen Grenzen der Patientin/des Patienten nicht mehr als unbedingt notwendig, ausschließlich zu deren Wohl und mit deren Einverständnis sowie insbesondere nicht mit insgeheim eigennützigen Absichten überschreiten dürfen. Sie sollen die Betroffenen in deren besonderer Situation der Bedürftigkeit achten.
Читать дальше
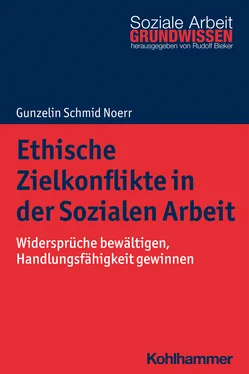
 Kap. 1.1) bereits erkennen konnte, zu widersprüchlichen Anforderungen führen können.
Kap. 1.1) bereits erkennen konnte, zu widersprüchlichen Anforderungen führen können.
















