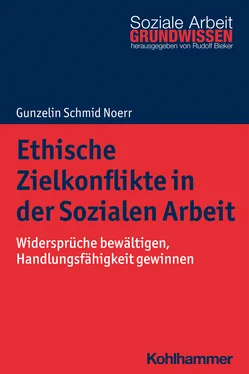1 ...6 7 8 10 11 12 ...18 Auch in den beruflichen Ethikkodizes der Sozialen Arbeit wird regelmäßig auf derartige Spannungsverhältnisse hingewiesen. So wird zum Beispiel im Vorwort der Proklamation »Ethics in Social Work, Statement of Principles« (2005) der Berufsverbände »International Federation of Social Workers« und »International Association of Schools of Social Work« darauf hingewiesen, dass die Problembereiche, mit denen es die Soziale Arbeit zu tun hat, folgendes beinhaltet:
• »die Tatsache, dass die Loyalität der Sozialarbeiter/-innen oft inmitten widerstreitender Interessen liegt,
• die Tatsache, dass Sozialarbeiter/-innen einerseits die Rolle des Helfers und andererseits die des Kontrolleurs ausfüllen,
• den Konflikt zwischen der Pflicht der Sozialarbeiter/-innen, die Interessen der Menschen, mit denen sie arbeiten, zu schützen, und den gesellschaftlichen Erfordernissen von Effizienz und Nützlichkeit,
• die Tatsache, dass die Ressourcen der Gesellschaft begrenzt sind.« (IFSW/IASSW 2005, 2)
Ähnlich wird im »Berufskodex Soziale Arbeit Schweiz« (2010) darauf hingewiesen, dass Spannungsfelder bestehen zwischen
• »der Anordnung von bestimmten Hilfsformen durch Dritte und den Erwartungen der Klientinnen und Klienten,
• der Loyalität zu den Adressatinnen oder Adressaten und der Loyalität zu Arbeitgebenden, auftraggebenden Trägerschaften oder weisungsbefugten Behörden,
• dem Selbstbestimmungsrecht und momentaner oder dauernder Unfähigkeit der Klientinnen und Klienten zur Selbstbestimmung,
• dem Beharren auf Selbstbestimmung durch die Adressatinnen und Adressaten und der Notwendigkeit der Übernahme von Schutz und Fürsorge für die Klientinnen und Klienten durch die Soziale Arbeit,
• dem Ansprechen oder Verschweigen von Fehlverhalten und der Loyalität zu Kolleginnen und Kollegen, die den ethischen Prinzipien zuwiderhandeln,
• dem Ansprechen oder Verschweigen von Sachverhalten beispielweise bei Behörden oder Arbeitgebenden und der Anwaltschaftlichkeit gegenüber Klientinnen und Klienten,
• dem ausgewiesenen Bedarf und der Beschränktheit der Ressourcen, die zu Rationierungsmaßnahmen führt.« (Avenir-Social 2010, 7)
Die Erörterung von Zielkonflikten war seit jeher ein klassisches Feld der philosophischen Ethik und wurde dies im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts auch in der Entwicklungspsychologie, vor allem in den Forschungen Lawrence Kohlbergs (1927–1987). Dieser konnte (im Anschluss an Jean Piaget) zeigen, dass es bei der Entwicklung des moralischen Urteils bei Kindern und Heranwachsenden eine Reihenfolge in dem Sinne gibt, dass die höheren Stufen nicht ohne Durchgang durch die niedrigeren erreichbar sind. Kohlberg bestimmte diese Stufen, indem er seinen Probanden moralische Dilemmata vorlegte, in denen sie sich virtuell zu entscheiden und ihre Entscheidung zu begründen hatten. Am bekanntesten daraus wurde das sogenannte »Heinz-Dilemma«:
»Eine Frau […] war dem Tode nahe, da sie an einer seltenen Form von Krebs litt. Es gab ein Medikament, von dem die Ärzte annahmen, dass es die Rettung bringen könnte. Es handelte sich um eine Art Radium, das ein Apotheker aus derselben Stadt jüngst entdeckt hatte. Der Apotheker verlangte 2000 Dollar, das Zehnfache dessen, was ihn die Herstellung kostete. Der Ehemann der kranken Frau, Heinz, suchte alle, die er kannte, auf, um sich das Geld zu leihen. Aber er konnte nur etwa die Hälfte des Kaufpreises zusammenbringen. Er sagte dem Apotheker, dass seine Frau im Sterben lag, und bat ihn, das Mittel billiger abzugeben oder ihn später bezahlen zu lassen. Aber der Apotheker lehnte ab. Heinz geriet in Verzweiflung und brach in die Apotheke ein, um das Medikament für seine Frau zu stehlen. – Hätte der Ehemann dies tun sollen? Warum?« (Kohlberg 1996, 147 f.)
Heinz’ moralisches Dilemma besteht darin, entweder einen Einbruchsdiebstahl zu begehen, um seiner Frau zu helfen, oder das Eigentumsrecht zu achten, seine Frau aber hilflos der Krankheit zu überlassen. Der Fall erscheint einigermaßen gekünstelt. Denn welcher Betroffene würde in Wirklichkeit hier ernsthaft zwischen Eigentum und Leben ›abwägen‹? Das Künstliche kommt auch daher, dass in der individualisierten Fallgeschichte von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen vollständig abstrahiert wird. Kein Wort zur Fragwürdigkeit der entsprechenden Eigentumsordnung und des Gesundheitssystems. Allerdings kommt es im Zusammenhang von Kohlbergs Untersuchungen, die allein diagnostischen Zwecken im Sinne der Zuordnung zu den Entwicklungsstufen des moralischen Bewusstseins dienen, bei der Befragung der Probandinnen zu der von ihnen präferierten Alternative nicht auf die Wahl selbst an, sondern auf die Antworten auf Nachfragen nach den Gründen. Denn daraus lässt sich auf die Kriterien schließen, nach denen die Probanden über Gut und Richtig entscheiden. Dass die geschilderte Dilemma-Situation unrealistisch ist, soll ihrer psychologisch-diagnostischen Funktion keinen Abbruch tun.
Allerdings ist in ethischen Diskursen nicht nur mit Erwachsenen, sondern auch mit Jugendlichen und Kindern wiederholt gezeigt worden, dass auch so manche andere kreative Lösung denkbar gewesen wäre, um das Dilemma zu entschärfen. Hier nur eine Lösung von vielen möglichen, die Anthony Weston erwähnt:
»[…] nehmen wir an, Heinz riefe die Zeitung an. Kaum etwas ist so wirksam wie schlechte Publicity. Auf diesem Wege ließen sich auch Spendengelder für die kranke Frau sammeln. Tausend Dollar – mehr braucht sie nicht – ist in der heutigen Welt nicht viel Geld.«
Und er betont,
»dass wir oft nur allzu bereit sind, angebliche ethische Dilemmas ohne weitere Fragen zu akzeptieren, als sei das Dilemma die einzige angemessene oder natürliche Form für ethische Probleme. Wir schließen die Möglichkeit eines kreativen Denkens aus, bevor wir überhaupt anfangen. Wir stellen enge und begrenzte Fragen, die uns – nicht überraschend – zu engen und begrenzten Antworten führen.« (Weston 1999, 54 f.)
Ein anderes, für Gerechtigkeitsfragen im Sinne Kohlbergs typisches Gedankenexperiment, das Kindern vorgelegt wurde, wird von Andreas Gruschka beschrieben: Ein Kind hat an seinem Geburtstag Kuchen in den Kindergarten mitgebracht. Nachdem alle vorhandenen Stücke gleichmäßig verteilt wurden, bleibt eines übrig, und die Frage ist nun, wer von den Anwesenden es aus welchen Gründen (ein Versprechen, besonders viel Hunger usw.) erhalten solle. Um das Dilemma zwischen der Einlösung verschiedener an sich berechtigter Ansprüche doch noch zu lösen und vor allem, um Streit und Ärger zu vermeiden, wurden nun einige kreative Ideen entwickelt (von vornherein mehr Kuchen mitbringen, das Stück wieder mit nach Hause nehmen usw.), die in der Versuchsanordnung nicht vorgesehen sind. Dabei nimmt die Bereitschaft sich zu unterwerfen mit dem Alter zu:
»Legt man älteren ein analoges Problem aus ihrer schulischen Erfahrung vor, so lässt sich in den Antworten immer weniger dieser Versuch einer aufhebenden Vermittlung der widerstreitenden Konzepte der Gerechtigkeit finden. Es setzt sich dafür zunehmend rigide die Gleichbehandlung aller gegen die Berücksichtigung individueller Unterschiede durch. Die aus dem Bedürfnis der Vermeidung von Streit und vielleicht aus der Erfahrung nicht knapper Güter im Elternhaus (alle Geschwister bekommen zunächst die gleiche Portion Eis, und wer noch einen Nachschlag will, bekommt auch den) resultierende Haltung […] zum Problem der Gerechtigkeit verflüchtigt sich fast restlos.« (Gruschka 1997, 36)
Im Unterschied zu den virtuellen Dilemma-Konstruktionen geht es in diesem Buch um ethische Antinomien, die die Praxis der Sozialen Arbeit tatsächlich prägen. Die entsprechenden Fallbeispiele dienen, anders als bei Kohlberg, nicht einer moralpsychologischen Diagnostik, sondern der Veranschaulichung und Erörterung professionsethischer Zielkonflikte. Es handelt sich nicht um derart einfache (wenn auch zwickmühlenartige) Ja-Nein-Entscheidungen wie im »Heinz-Dilemma«, sondern um ethische Spannungsfelder, die sich im Laufe der Betreuungsprozesse, also der Beziehungen zwischen Fachkräften und Klientinnen, entwickeln. In ihnen treten die möglichen Entscheidungsalternativen zumeist in unterschiedlichen Mischungen auf. Sie müssen sich nicht vollständig ausschließen, verlangen aber immer wieder neu ihre Verhältnisbestimmung. Grundsätze wie Nähe und Distanz, Fremdbestimmung und Selbstbestimmung usw. mögen sich zwar begrifflich ausschließen, in der Praxis aber geht es um Wege ihrer Vermittlung, Balance oder Abwägung. Sollen diese Entscheidungsprozesse nicht allein ›aus dem Bauch heraus‹ ablaufen, sondern professionellen Ansprüchen genügen, dann bedürfen sie professionsethisch geklärter Kriterien und Abläufe.
Читать дальше