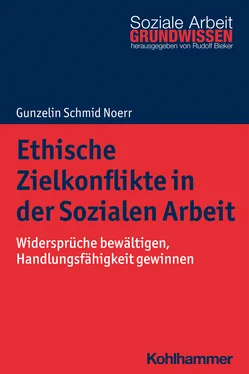Man kann die Moral als eine Art Grammatik verstehen, mittels derer die Mitglieder einer sozialen Gemeinschaft ihre Ansprüche und Rücksichten regeln. Dabei beziehen sie sich auf bestimmte Standards des sozialen Miteinanders wie Respekt, Wohltun, Rücksicht, Wahrhaftigkeit o. ä. Dies kann auch indirekt geschehen, indem sie jemandem das jeweilige Gegenteil (Respektlosigkeit, Verletzung, Rücksichtslosigkeit, Lüge) vorwerfen. Die moralische Grammatik funktioniert wie die der verbalen Sprache vielfach nicht bewusst. Man könnte dies die implizite Sprache der Moral nennen. D. h., wir wenden die Moral zumeist intuitiv an, ohne uns ausdrücklich auf sie zu beziehen. Wenn Moral in diesem Sinn eine Art Sprache ist, dann ist Ethik eine »Metasprache«, eine Sprache über Sprache, eine Reflexion darüber, wie es zu den im moralischen Sprechen enthaltenen Ansprüchen kommt und ob sie berechtigt sind oder nicht.
Wie die Sprache bei den einzelnen Angehörigen einer Sprachgemeinschaft großenteils unbewusst funktioniert, so auch die Moral. Bewusst wird sie uns eher in Konfliktsituationen, wenn verschiedene moralischer Ansichten aufeinanderstoßen oder verletzt werden. Die moralische Selbstverständlichkeit, dass es gegen die moralischen Werte und Normen des Wohltuns ist, andere grundlos oder eigensüchtig zu verletzen, wird dann zum Problem, wenn wir oder andere davon betroffen sind. Wir reagieren mit moralischen Gefühlen von Empörung, Wut, Schuld oder Scham. Haben wir die Gelegenheit, diese Gefühle zu überdenken, dann kommen an deren Untergrund verborgene Ansichten, Erfahrungen, Wünsche oder Ängste zum Vorschein. Moralische Grenzen zu erfahren, spiegelt immer auch die eigene Biographie wider, insofern wir Einstellungen oder Handlungen jenseits dieser Grenzen nicht ohne weiteres in die eigenen Handlungsmuster integrieren können.
Moral ist nur eine Art von Orientierungen des sozialen Handelns neben anderen. Unser Empfinden und Handeln wird auch dadurch bestimmt, was für uns und unsere soziale Umwelt als üblich, ausgefallen, angesagt, nützlich, modern, schön, richtig, gerecht, rechtlich erlaubt oder geboten, anerkannt usw. gilt. Eine der wichtigsten Regularien, die für die Soziale Arbeit besonders relevant sind, ist das Recht. Die Soziale Arbeit bewegt sich in Deutschland heute auf der rechtlichen Grundlage des »Bürgerlichen Gesetzbuches« und insbesondere des »Sozialgesetzbuches«. Das Recht unterscheidet sich von Moral und Ethik vor allem dadurch, dass es mit ›harten‹ Sanktionen, also Strafen bewehrt ist. Seine Einhaltung kann notfalls durch die Staatsgewalt erzwungen werden. Ein Teil der moralischen Regeln der Rücksichtnahme auf die berechtigten Interessen Anderer ist zugleich rechtlich abgesichert, weil sie für besonders wichtig gelten. Andere Werte, zum Beispiel solche eines erfüllten und gelingenden Lebens, sind kaum rechtsfähig. Andererseits gibt es viele rechtliche Gesetze und Verordnungen, die keine moralische Bedeutung haben (außer der, dass gesetzkonformes Verhalten allgemein als moralisch wünschenswert gilt). So bilden Recht und Moral/Ethik zwei Bereiche mit einer gewissen Schnittmenge. Historisch haben sie sich erst in der Moderne ausdifferenziert. Der Richter des »Kreidekreises« fungiert noch zugleich als ethische Instanz.
Wie rechtliche Regeln und Gesetze können auch die moralischen Regeln zum eigenen Vorteil bewusst umgangen oder auch instrumentalisiert werden. Demgegenüber mag es erforderlich sein, die moralischen Vorannahmen ausdrücklich zur Sprache zu bringen. Damit aber wird sehr bald so etwas wie ein vermintes Gelände betreten. Denn Moral bei Anderen explizit einzufordern, stellt nur allzu rasch deren Selbstverständnis in Frage. Sobald eine Auseinandersetzung eine bestimmte Schärfe erreicht hat, erfolgt zumeist auch eine bewusste moralische Herabsetzung des Gegners. Persönliche Kritik wird dann zur Kritik der moralischen Persönlichkeit. Nichts bietet sich leichter zum Streit, aber auch zum Missbrauch an als Moral und Ethik.
Eine im Alltagsleben gängige Form dieses Missbrauchs ist das Moralisieren (die »Moralpredigt«), und es ist wichtig, ethisches Argumentieren nicht damit zu verwechseln. Wer Moral ›predigt‹, redet seinem Gegenüber ins Gewissen. Er will schlechtes Gewissen erzeugen und zu Reue und Umkehr bewegen. Dabei werden Werte und Normen beschworen, die als solche nicht in Frage gestellt werden. In der Erziehung ist die Wirkung von Moralpredigten, wie man weiß, sehr gering. Der »moralische Zeigefinger« ist zu Recht verrufen und fachlich-pädagogisch außer Kurs gesetzt. Auch in der Politik kann Moral allzu leicht missbraucht werden, indem sie politisches Argumentieren verdrängt. Kaum eine aggressive Übeltat kommt ohne den Versuch einer moralischen Verschleierung als »Notwehr« oder »gerechte Vergeltung« aus.
Auch in der beruflichen Sozialen Arbeit hat das Moralisieren keinen Platz. Das wird besonders deutlich in Praxisbereichen, in denen es die Fachkraft gelegentlich mit Menschen zu tun hat, deren Moralauffassung von der eigenen deutlich abweicht. So äußert sich der Sozialarbeiter Martin Klemke, der als Verfahrensbeistand an einem Amtsgericht die Aufgabe hat, die Interessen von Minderjährigen in kindschaftsrechtlichen Verfahren zu vertreten:
»Ich würde im Beruf niemals eigene Moralvorstellungen umsetzen wollen, weil die eigenen Moralvorstellungen längst nicht deckungsgleich sein müssen mit allgemeinen Ansichten. […] Höflichkeit zum Beispiel und Achtung vor den anderen Menschen haben für mich persönlich einen ganz hohen Wert. Aber ich könnte niemals jemanden urteilsmäßig in irgendeiner Form benachteiligen, nur weil er unhöflich ist.«
Der Sozialarbeiter unterscheidet hier genau genommen drei Ebenen des Moralischen, nämlich
a. die »allgemeinen Ansichten«, d. h. die einer bestimmten Kultur und einer bestimmten Epoche vorherrschenden Wert- und Normvorstellungen,
b. diejenigen Anteile davon, die ihm ›persönlich‹ in seinem Lebensumfeld besonders wichtig sind und
c. diejenigen Anteile, die seinem Berufsethos entsprechen.
Stattdessen würde Moralisieren hier bedeuten, die Unterschiede zwischen persönlichen Erwartungen und beruflichen Anforderungen derart zu verwischen, dass die spezifisch berufsethischen Ansprüche der Betroffenen auf Recht und Gerechtigkeit davon beeinträchtigt werden.
Auch die Klientinnen der Sozialen Arbeit neigen immer wieder zu einem fragwürdigen Moralisieren, nicht zuletzt, um so die Verantwortung für Schwierigkeiten von sich selbst auf andere abzuwälzen. Die Sozialarbeiterin Else Wickert, die in der Suchtberatung tätig ist, berichtet:
»Insgesamt stellt man hier in der Beratung immer wieder fest, dass Moral in den einzelnen Lebenszusammenhängen eine sehr große Rolle spielt […]. Also jetzt hatte ich eine Situation, wo die Tochter einer Klientin schwanger ist und der Vater von dem Kind sich jetzt entschieden hat: Ich möchte das Kind, aber die Frau nicht mehr. […] Im Grunde geht es um das Problem: Die Mutter hat die Tochter schon nicht losgelassen, die Tochter will das Kind jetzt bekommen, damit sie was hat, woran sie sich festhalten kann. […] Es geht ums Loslassen, darum, dass jeder Verantwortung für sein Leben übernimmt, und es geht auch um Aushalten und zu ertragen, wenn die Tochter sich dafür entscheidet, mit so einem Mann zu leben. […] Die Mutter schwingt die große Moralkeule mit der Frage: Wie kann sich ein Mann so verhalten, da macht er ihr das Kind und jetzt will er nix mehr von ihr wissen. Das sind moralische Aspekte, das ist ein Beispiel dafür, wo man einfach auch daran mit den Klienten arbeiten muss, eine Einstellung zu verändern oder zu hinterfragen oder mal zu gucken, was hat sie davon, wenn sie diesen Mann jetzt verantwortlich macht und nicht fragt: Was ist eigentlich mein Anteil, oder wie sieht eigentlich die Beziehung zu meiner Tochter aus, warum kann ich eigentlich meine Tochter nicht loslassen? Es ist ja viel einfacher, die moralische Keule zu schwingen und jemand anderes verantwortlich zu machen.«
Читать дальше