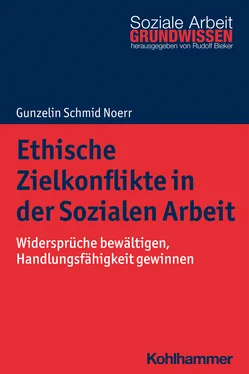Ethische Zielkonflikte gehören auch in anderen Bereichen der Sozialen Arbeit sozusagen zum täglichen Brot der professionell Tätigen. Wie ist beispielsweise bei der Schwangerschaftskonfliktberatung das gesetzlich festgelegte Ziel, das Leben des Kindes zu erhalten, mit der für Beratungen notwendigen Ergebnisoffenheit zu vereinbaren? Wie verhalten sich bei der Drogenarbeit oder beim Umgang mit Suizidgefährdeten Eingriffspflicht und Selbstbestimmungsrecht? Welches Maß an Selbstbestimmung sollen rechtliche Betreuerinnen ihren Klienten zugestehen und zumuten, für die sie zu entscheiden und zu handeln haben? Derartige Fragestellungen weisen darauf hin, dass die verschiedenen ethischen Prinzipien oder Leitlinien nicht ohne weiteres harmonisch zusammenstimmen.
Am bekanntesten, und oft genannt, sind die Gegensatzpaare Nähe und Distanz sowie Hilfe und Kontrolle, die nicht nur, aber auch ethische Anteile haben. Auch sonst lassen sich vielfältige ethische Konfliktbereiche dieser Art nennen, etwa zwischen dem gesellschaftlichen und dem klientelbezogenen Mandat der Sozialen Arbeit, zwischen Anforderungen der fachlichen Intensität und der ökonomischen Sparsamkeit, zwischen Gerechtigkeit und Gleichheit oder zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Nach welchen ethischen Kriterien solche Beurteilungen und Entscheidungen unter dilemmatischen Bedingungen vorzunehmen sind, ist die Fragestellung dieses Buches. Zunächst ist zu bestimmen, was hier unter »Ethik« und »Moral« zu verstehen ist.
1.2 Ethik und Moral: Orientierung an berechtigten Bedürfnissen/Interessen Anderer
Die Ethik thematisiert das Empfinden, Denken und Handeln hinsichtlich seiner Lebensförderlichkeit und sozialen Verantwortlichkeit. Sie ist die Theorie des »Ethos« bzw. der »Moral«. Was ist nun Moral? Hier ist von vornherein ein immer noch verbreiteter, viel zu enger Begriff von Moral auszuräumen. Cornelia Holsten, eine sehr erfahrene Sozialarbeiterin – sie war schon in vielen Feldern der Sozialen Arbeit tätig, arbeitet nun als Fallmanagerin bei der Arbeitsagentur –, erweist sich sonst in dem Interview, aus dem hier zitiert wird, als sehr umsichtig. Ganz zu Beginn dieses Interviews antwortet sie auf die Frage: »Siehst du irgendwo Moralprobleme in der täglichen Arbeit?«:
»Nö, ich eigentlich nicht. Ich geh da sehr offen und frei mit um. Moral hab’ ich nicht so viel mit am Hut, ich bin nicht in der Kirche. Es gibt ethische Probleme schon mal, aber die sind zum Teil darin begründet, wenn es ausländische Mitbürger sind oder Mitbürger bestimmter Religionen, wo man einfach drauf Rücksicht nehmen kann, soll, muss – das. Aber ansonsten, nee. Fallmanagement ist immer offen. Fallmanagement spricht alles an. Also alle Drogenprobleme, Schulden, Missbrauch, häusliche Gewalt, quer Beet. Fallmanagement ist immer ein ganz offenes Gespräch, weil sonst ist es kein Fallmanagement. Also gibt’s da auch eigentlich keine Einschränkungen.«
An dieser Antwort fällt Mehreres auf, das auf Missverständnisse des Moralischen verweist:
• Die Sozialarbeiterin bezieht Moral nur auf ihre eigene Arbeit als Fallmanagerin, nicht auch auf Probleme ihrer Klienten.
• Sie versteht Moral offenbar als gegensätzlich zu ihrer eigenen »offenen und freien« Umgangsweise – »Fallmanagement ist immer ein ganz offenes Gespräch« – als geschlossen, unfrei. Sie berücksichtigt nicht, dass Moral ebenso Motivation für Befreiung von Zwängen sein kann.
• Sie setzt Moral mit religiöser oder kirchlicher Moral gleich (mit der sie »nichts am Hut hat«). Aber auch außerhalb derer gibt es Moral.
• Sie unterscheidet nicht zwischen Moral und Ethik. Die letztere verengt sie wiederum auf eine Rücksichtnahme auf nicht einheimische religiöse Bräuche.
Die Gründe für diese Fehlinterpretationen des Moralischen sind wohl darin zu suchen, dass in unserer Gesellschaft die meisten Menschen, sofern sie einen christlichen kulturellen Hintergrund haben, Moral nach wie vor als kirchliche Lehre kennenlernen. Auf die Frage nach Beispielen für moralische Gebote fallen ihnen in der Regel als erstes die Zehn Gebote ein. Eine andere, weit verbreitete Assoziation zum Moralischen ist ebenfalls immer noch die von sexuellen Einschränkungen. Das ist insofern nicht verwunderlich, als Sexualität ein Feld aktiver oder passiver Grenzüberschreitungen ist und eng mit Erfahrungen nicht nur von Glück, sondern auch von Leiden verbunden ist. Glück, Leid, Leidvermeidung und damit Sexualität waren in traditionalen Gesellschaften durch viele Bräuche, Werte, Normen und Regeln eingehegt, die heute in der säkularisierten und individualisierten Gesellschaft immer weniger strikt gelten. Die Menschen weisen in ihrer Mehrheit kirchliche Einschränkungen und verpflichtende Sexualverbote ab. Damit verliert auch »Moral« ihre Reputation.
Dies aber ist, wie schon angedeutet, ein Missverständnis. Betrachten wir, um es aufzuklären, Moral nicht (wie die zitierte Sozialarbeiterin) aus der Innenperspektive (»Moral hab’ ich nicht so viel mit am Hut«), sondern von außen, aus psychologischer, soziologischer oder anthropologischer Perspektive. Dann lässt sie sich als eine Gesamtheit von Einstellungen und Praktiken bestimmen, die die Individuen auf teils bewusste, teils nicht bewusste Weisen dazu orientiert, auf die berechtigten Interessen Anderer Rücksicht zu nehmen. Die Moral fungiert, anthropologisch gesehen, als psychosoziale Barriere gegenüber der hohen Verletzbarkeit der Menschen untereinander und als Richtschnur für die Berücksichtigung ihrer Bedürftigkeit. Moral ist Ausdruck der psychosozialen Bindung einer wie immer gearteten Gruppe (vgl. Durkheim 1967, 87).
Moral haben die Menschen grundlegend, da ihr Zusammenleben nicht wie das tierische, wesentlich instinktgesteuert verläuft, sondern durch kulturelle Bedeutungen, Lernvorgänge und Traditionen vermittelt ist. Die Individuen entwickeln ihre moralischen Einstellungen während der Kindheit und Jugend, aber auch noch im Erwachsenenalter, in den Dimensionen der sozialen Wahrnehmung, der emotionalen Intelligenz und der kognitiven Urteilsfähigkeit. In der frühen Kindheit, sobald die Nahbeziehungen Kontur gewinnen, wirkt eine fremde Person ängstigend. Sie wird zunächst auch nicht oder nur reduziert in moralisch inkludierender Perspektive wahrgenommen werden. Entsprechend ist auch in gesellschaftlich-geschichtlicher Hinsicht eine universalistische Moral, die den Menschen thematisiert, eine relativ späte Errungenschaft (in unserem Kulturkreis in der Antike und im frühen Christentum).
Die moralischen Bindungen fallen, je nach Gruppe, enger oder lockerer aus. Dementsprechend empfinden wir in der Regel gegenüber den eigenen Kindern engere Bindungen als gegenüber den anderen Familienmitgliedern, diesen gegenüber wiederum engere als gegenüber Nachbarinnen, Fremden oder der Menschheit insgesamt. Entsprechend unterschiedlich empfinden wir auch moralische Anforderungen. Wir verhalten uns ihnen gegenüber grundsätzlich auf zweierlei Weise, entweder in der subjektiven Perspektive einer bestimmten Person in einer bestimmten Situation mit bestimmten Anderen oder in der intersubjektiven Perspektive auf für alle geltende Verpflichtungen im Sinne des Allgemeinwohls. Demzufolge hat die Moral zwei Seiten, eine sozial verbindliche und eine individuell wahlfreie. Die Individuen müssen Wertkonflikte vielfach in eigener Verantwortung entscheiden, indem sie je eigene Prioritäten setzen. Demgegenüber bildet der Bereich der sozialen Moral die Grundlage und die Begrenzung der individuellen moralischen Entscheidungen.
Beide Moralformen können unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen miteinander harmonieren oder disharmonieren. Unsere heutige Kultur schreibt der selbstbestimmten Individualität eine sehr hohe Bedeutung zu. Die individuellen und gruppentypischen Unterschiede der Moralen können zwischen verschiedenen Individuen oder gesellschaftlichen Gruppen zu Missverständnissen, Gegensätzen und Konflikten beitragen. So kann auch heute noch eine enge Familiensolidarität durchaus mit einer menschenfeindlichen Einstellung gegenüber Fremden einhergehen.
Читать дальше