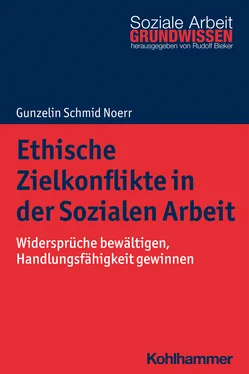Der Richter aus einem früheren Jahrhundert hatte zu beurteilen, welcher der beiden Frauen das Kind zustand. Das Besondere an der Geschichte ist, dass er der Fragestellung eine ethische Bedeutung gab, nämlich die, welche der streitenden Parteien die Gewähr dafür bot, sich wahrhaft, d. h. nicht nur aus Berechnung, um das Kind zu kümmern, und dass er eine unerwartete Methode erfand, dies herauszubekommen. Es ging, nach heutigen rechtlichen und sozialarbeiterischen Fachbegriffen, um die Abwehr einer Gefährdung des Kindeswohls bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Elternrechts. Sehen wir von der heute gegebenen Möglichkeit ab, mittels Gentests die biologische Abkunft des Kindes zweifelsfrei zu ermitteln, dann stellt der Richter bei Brecht das Kindeswohl über das elterliche Erziehungsrecht, was durchaus unseren modernen wohlfahrtsstaatlichen Prinzipien entspricht. Wenn die leibliche Mutter das Kind misshandelt, hat der Staat als »Wächter« über sein Wohlergehen für einen Familienersatz zu sorgen. »Kindeswohl« ist ein sogenannter unbestimmter Rechtsbegriff, der u. a. im Jugendhilferecht von größter Bedeutung ist. Unbestimmte Rechtsbegriffe sind in ihrer Bedeutung letztlich von Gerichten auszulegen, die individuelle Prüfungen der Sachverhalte vornehmen müssen, wobei sie sich an den jeweils geltenden fachlichen Wissensbeständen und Normvorstellungen zu orientieren haben.
Ein hilfloses Kind im Stich zu lassen oder ihm Gewalt anzutun, ist geradezu ein Urbild von Unrecht. Auch wenn in den erwähnten Dichtungen vielleicht allzu plakativ Gut und Böse gegenübergestellt werden und wenn sich Soziale Arbeit und Justiz heute anderer Mittel der Wahrheitsfindung bedienen als eines dramatischen Rollenspiels im Kreidekreis, ist doch die dargestellte Entscheidungsproblematik an sich durchaus lebensnah. Dies zeigt das folgende Fallbeispiel aus einem Interview mit einer Mitarbeiterin eines Jugendamts. Diese wird von einem Krankenhaus über ein Baby informiert, das dort wegen einer Gehirnverletzung mit Blutungen in den Augen behandelt wurde. Die Information erfolgte, weil man den Verdacht hatte, es mit einem »Schüttelbaby« zu tun zu haben (überforderte Eltern, die ihr schreiendes Kind durch heftiges Schütteln seines Kopfes zur Ruhe bringen wollen, können damit ein »Schütteltrauma« mit gravierenden Schäden verursachen). Elke Ahlers, Sozialarbeiterin im Jugendamt, berichtet:
»Wir haben das Baby dann erst mal in Obhut genommen. Dieses Kind ist auf ganz aufwendige Weise entstanden. Die Eltern haben eine künstliche Befruchtung gehabt, das Kind verloren, das ist das zweite Kind aus einer künstlichen Befruchtung. Die kämpfen natürlich wie die Löwen, sie behaupten, sie hätten das Kind nicht geschüttelt, es wäre ein Impfschaden. […] Also ich kann gut verstehen, was für Nöte die haben. Dass die das zurückhaben wollen. Aber da läuft natürlich in erster Linie das Kinderschutzthema an, das steht an erster Stelle. Dieses Kind ist jetzt in ’ne Bereitschaftspflegefamilie gegangen, die Eltern haben zweimal wöchentlich Besuchskontakte. Und wir müssen da jetzt abwägen und aufpassen. Das Kind hat natürlich noch ’ne Bindung zu seinen Eltern, das muss man ja, mit Bindungstheorie usw., auch beachten. Und sollte es sich rausstellen, das ist ein Impfschaden, dann ist das so tragisch –. Es gibt inzwischen zwei Gutachten, die besagen, das ist kein Impfschaden. Die Eltern wenden sich gerade an ’n Fachmann, der den Impfschaden darlegen soll. Dann würde für uns allerdings immer noch zwei zu eins stehen und die Entscheidung würde nicht für die Familie ausfallen. Das Kind würde dann in ’ne Bereitschaftspflege- oder in ’ne Dauerpflegefamilie vermittelt werden. Als Mutter selber kann ich die Tragik total nachvollziehen und die Sorgen, Ängste und Nöte, die die haben.« [Mit den Kursivierungen werden hier und in den anderen Interview-Passagen Betonungen wiedergegeben.]
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter kommunaler Jugendämter haben öfters darüber zu entscheiden, ob in einer Familie eine Vernachlässigung eines Kindes oder Gewalthandlungen gegenüber diesem vorliegen und ob diese so schwerwiegend sind, dass sie eine sogenannte »Inobhutnahme« wegen Gefährdung des »Kindeswohls« veranlassen sollen. Das ist für alle Beteiligten, für die Familienmitglieder wie für die professionellen Kräfte, eine besonders belastende Situation. Die Entscheidung über das relevante Maß der Kindeswohlgefährdung ist schwierig, da diese zumeist im Verborgenen geschieht. Die Vielfalt der möglichen Fallvarianten ist groß. Was als unbedingt zu wahrendes Kindeswohl gilt und wie die allgemeinen Kriterien des körperlichen, geistigen und seelischen Wohls auf den besonderen Fall anzuwenden sind, muss jeweils nach dem verfügbaren Wissen über den Sachverhalt, nach fachlichen Standards und gemäß kultureller Übereinkünfte und ethischer Kriterien ausgelegt werden.
Die Sozialarbeiterin Elke Ahlers ist sich der Notwendigkeit einer nachhaltigen Entscheidung ebenso wie des möglichen Risikos einer Fehlentscheidung vollständig bewusst. Die Notwendigkeit bezieht sich auf die Wahrung des »Kindeswohls«. Dieses gilt dann als unmittelbar gefährdet, wenn ein von der Familie drohender erheblicher Schaden für das körperliche, seelische oder geistige Wohl des Kindes sicher anzunehmen ist. Dem gegenüber steht das Elternrecht, das den Schutz der Eltern vor staatlichen Eingriffen in die Erziehung der Kinder beinhaltet. Das Risiko resultiert nicht nur aus der Ungewissheit darüber, was tatsächlich vorgefallen ist, sondern auch aus der Befürchtung, dass auch eine richtige Entscheidung unerwünschte Nebenfolgen haben könnte.
Während nun die Wahrung des Kindeswohls einen klaren Vorrang gegenüber dem Elternrecht hat (was zur Inobhutnahme des Kindes führt), werden die Verhältnisse dadurch komplizierter, dass zum Kindeswohl auch die psychische Bindung des Babys an die Eltern gehört, die wiederum durch die Inobhutnahme gefährdet wird. Einerseits könnte die Überstellung des Kindes in eine Pflegefamilie zur Störung der psychologisch so wichtigen Elternbindung des Kindes führen. Andererseits könnte die Rückführung des Kindes zu nicht gefestigten Eltern erneut Misshandlungen heraufbeschwören. Die Sozialarbeiterin hat also unter Bedingungen unsicheren Wissens mit den unterschiedlichen Gefährdungen des Kindeswohls zu rechnen.
Eine (annähernd) richtige Entscheidung setzt eine (annähernd) richtige Erkenntnis des Sachverhalts voraus. Für die Version der Eltern scheint die Vorgeschichte zu sprechen: Sie haben das Kind nicht irgendwie oder ungewollt bekommen, und insofern wäre ihnen wohl eher eine besondere Sorgfalt bezüglich des Kindes zuzutrauen. Aber psychologisch wären auch andere gegenläufige (bewusste oder unbewusste) Motive von vornherein nicht auszuschließen. Andererseits mag man den medizinischen Gutachten ein größeres Maß an Objektivität und Tatsachenfeststellung zutrauen. Aber auch Gutachter sind nicht von vornherein gegen Irrtümer gefeit. Und was, wenn sich mehrere Gutachten widersprechen? Dann scheint nichts anderes übrig zu bleiben als die quantitative Abwägung »zwei zu eins« oder ein weiteres (Ober-)Gutachten.
Die Inobhutnahme stellt eine vorläufige Unterbringung eines Kindes außerhalb seiner Familie (Heim, Pflegefamilie) dar, bis eine familiengerichtliche Entscheidung getroffen wird. Diese hängt im Wesentlichen von der weiteren Aufklärung des Sachverhalts und der Hilfemöglichkeiten seitens des Jugendamts ab. Allerdings könnte das Jugendamt auch auf Maßnahmen zurückgreifen, mit denen die Gefahren zu vermindern wären, die aus einer wie auch immer ausfallenden Entscheidung resultieren könnten. Der hier einschlägige § 1666 BGB sieht eine Reihe entsprechender Maßnahmen vor, u. a. solche wie Hilfeplanerstellung oder Erziehungsberatung, die dazu geeignet sein können, eine vollständige Entziehung des elterlichen Sorgerechts ebenso wie ein unkontrolliertes Verbleiben des Kindes in einer gefährdenden Umwelt zu vermeiden. Am Ende stünde statt einer aufgrund von Unwissenheit riskanten Entscheidung ein Kompromiss in Gestalt von praktischen Maßnahmen.
Читать дальше