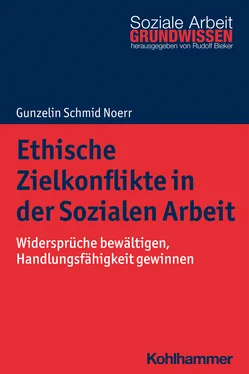• Direktivität oder Non-Direktivität,
• Loyalität gegenüber Arbeitgebenden oder gegenüber Klientinnen,
• Gesinnungs- oder Verantwortungsethik.
Gegen die Vergegenwärtigung von Antinomien der Sozialen Arbeit könnte eingewandt werden, dass dadurch Entscheidungen eher blockiert als gefördert werden könnten. Ist es nicht überflüssig, über Alternativen weiter nachzudenken, wenn sie alle unvermeidliche Nachteile haben? Bestünde vielleicht die beste Entscheidung darin, einer Entscheidung möglichst aus dem Weg zu gehen? Jedoch liefe eine solche Enthaltsamkeit den professionsethischen Ansprüchen entgegen, sich der Verantwortung für das eigene Handeln (oder Unterlassen) zu stellen. Gerade wenn Widersprüche nicht praktisch aufzulösen sind, macht ein entsprechendes Problembewusstsein Entscheidungen letztlich umso besser.
Die antinomischen Anforderungen, die in diesem Buch erörtert werden, sind als solche überwiegend keine spezifisch ethischen Begriffe. Von ihnen, wie zum Beispiel von Hilfe und Kontrolle oder von Nähe und Distanz, ist in Praxis und Theorie sonst eher unter psychologischen, soziologischen, kommunikationstheoretischen, sozialhistorischen und anderen Aspekten die Rede. Demgegenüber geht es hier um die ethische Bedeutung dieser Begriffe und der von ihnen bezeichneten Handlungskonstellationen. Diese Bedeutung besteht im geforderten Maß der Achtung Anderer, der Berücksichtigung ihrer legitimen Interessen und ihres Wohlergehens, der Achtsamkeit und Fürsorge.
Die antinomische Struktur der Sozialen Arbeit wurde und wird in der Fachliteratur immer wieder festgestellt. Weniger Aufmerksamkeit wird jedoch im Allgemeinen darauf verwendet, wie diese Struktur von den Fachkräften erlebt wird und wie diese mit ihr umgehen. Um diesen Mangel ein Stück weit auszugleichen, wird in diesem Buch auf entsprechende empirische Materialien in Gestalt von Transkriptionen der Interviews mit Fachkräften zurückgegriffen. Anhand dieser Protokolle werden Bedingungen und Möglichkeiten des sozialberuflichen Handelns angesichts widersprüchlicher Anforderungen reflektiert.
Ein Auswahlkriterium für die Behandlung der Antinomien in diesem Buch war ihre Gewichtung in den Interviews. Diese wurden von Studierenden (in der Regel zu zweit) mit Praktizierenden der Sozialen Arbeit im Rahmen meiner Seminarveranstaltungen zur Praxisforschung der Sozialen Arbeit an der Hochschule Niederrhein, Mönchengladbach, durchgeführt. Das Verfahren war an die Methodik des Narrativen Interviews angelehnt, wobei die Ausgangsfrage auf den persönlichen Umgang mit ethischen Problemen in der alltäglichen Praxis gerichtet war. Die transkribierten Interviews wurden dann in der Großgruppe der Seminarteilnehmenden besprochen. Im Zusammenhang des vorliegenden Buches werden die zitierten Interviews nicht als ganze hinsichtlich ihrer verschiedenen Bedeutungsebenen interpretiert, sondern nur auszugsweise zur praxisnahen Veranschaulichung der theoretischen Fragestellungen verwendet. Als unveröffentlichte Typoskripte werden sie nicht bibliographisch nachgewiesen. Sie sind selbstverständlich anonymisiert, die Namen der Interviewten wurden zufällig gewählt. Mit den Kursivierungen werden betonte Wörter wiedergegeben. Den interviewenden Studierenden wie auch den interviewten Fachkräften sei hiermit herzlich gedankt.
Über die Verwendung von weiblichen und männlichen Sprachformen in öffentlichen Diskursen einschließlich wissenschaftlichen Texten ist viel gestritten worden und wird weiterhin diskutiert. Einerseits sind Bezeichnungen wie »Sozialarbeiter« oder »Klient« Gattungsbegriffe. Sie haben, wie andere Wörter auch, ein grammatisches Geschlecht, das in der großen Mehrzahl ohne Bezug zum biologischen Geschlecht steht. Sie beziehen sich auf Menschen, die durch geschlechtsunabhängige Kriterien wie Beruf oder institutionelle Funktion gekennzeichnet sind. Von daher ließe sich die entsprechende traditionelle Redeweise rechtfertigen, die sich in vielen Fällen aufs männliche generische Geschlecht beschränkt.
Andererseits werden solche Bezeichnungen aber auch als Individualbegriffe verwendet, die in einem gegebenen Zusammenhang bestimmte Individuen mit Bezug auf ihre soziale Funktion bezeichnen. Demgemäß wäre bei der Verwendung der Begriffe das biologische Geschlecht zu berücksichtigen. Da aber Gattungs- und Individualbegriffe sich nur logisch, nicht aber von ihrem Erscheinungsbild her unterscheiden und da im allgemeinen Sprachgebrauch über logische Grenzen hinweg biologische Konnotationen wirkmächtig sind, hat man zur Vermeidung geschlechtsbezogener sozialer Diskriminierung Zeichen wie Binnen-I, Sternchen, Unterstriche, Schrägstriche, Klammern, Doppelpunkte eingeführt. So möchte man biologisch-geschlechts-neutrale Gattungsbegriffe erschaffen. Sie haben nur den Nachteil, stilistisch unschön oder nicht oder nur holpernd aussprechbar zu sein.
Bei der Bezeichnung von Personen durch Gattungsbegriffe verzichte ich deshalb auf eine einheitliche Verwendung der weiblichen oder männlichen Form und verwende stattdessen, sofern nicht neutrale Bezeichnungen möglich sind, zufällig die eine oder andere. Sofern damit allgemeine Aussagen über die Soziale Arbeit und ihre Fachkräfte gemacht werden, ist das jeweils andere Geschlecht mitgemeint. Stehen die Bezeichnungen dagegen als Individualbegriffe im Zusammenhang mit der Erörterung eines bestimmten Falls, dann richten sie sich nach dem biologischen Geschlecht der jeweiligen zitierten Fachkraft.
Gunzelin Schmid Noerr, Frankfurt am Main
1 Riskante Entscheidungen treffen Werte im Konflikt



Was Sie in diesem Kapitel lernen können
Ein Beispiel aus der Kinder- und Jugendhilfe leitet in die Problematik der sich widerstreitenden Werte ein. Um deren Bedeutung zu ermessen, müssen zunächst die Grundbegriffe »Ethik« und »Moral« und ihr Stellenwert im Rahmen der Sozialen Arbeit vorläufig geklärt werden. Sodann wird in die Thematik der ethischen Antinomien in der Sozialen Arbeit eingeführt. Die ethische Reflexion der Sozialen Arbeit wird als gegenläufige Suchbewegung von »Top-down« und »Bottom-up« charakterisiert.
In einer altchinesischen Dichtung aus dem 14. Jahrhundert wird die folgende Geschichte erzählt: Ein reicher Mann hat zwei Frauen, eine Hauptfrau, die kinderlos geblieben ist, und eine Nebenfrau, die ein Kind von ihm bekommen hat. Der Hauptfrau, die intrigant und skrupellos ist, gelingt es, das Kind als ihres auszugeben und der Nebenfrau wegzunehmen. Die Frauen streiten heftig darüber, schließlich kommt der Fall vor Gericht. Der Richter verfügt, dass beide Frauen gleichzeitig versuchen sollten, das Kind aus einem mit Kreide markierten Kreis jeweils zu sich zu ziehen. So werde sich zeigen, wem es gehöre. Das Gezerre beginnt. Schließlich lässt die Nebenfrau das Kind los, damit es nicht verletzt werde. Dadurch aber erweist sie sich vor den Augen des Richters als die wahre Mutter. Der Richter spricht ihr das Kind zu.
Dieser Stoff wurde in der Moderne mehrfach literarisch bearbeitet, u. a. in den 1940er Jahren von Bertold Brecht in seinem Theaterstück Der kaukasische Kreidekreis. Dabei veränderte Brecht auf bezeichnende Weise die Grundkonstellation. Er lässt die leibliche Mutter mit einer Magd um das Kind streiten. Diese Mutter hatte zuvor ihr Kind schmählich im Stich gelassen, während die Magd aufopferungsvoll für es gesorgt hatte. Bei Brecht, der nicht an eine ›Stimme des Blutes‹ glaubt, reißt die leibliche Mutter im Kreidekreis gewaltsam das von ihr vernachlässigte Kind an sich, während die Magd es rücksichtsvoll loslässt, woraufhin der weise Richter der Magd das Kind zuspricht. Die »Moral der Geschichte« ist bei Brecht, »dass da gehören soll, was da ist, denen, die gut für es sind, also die Kinder den Mütterlichen, damit sie gedeihen« (Brecht 1977, 2105).
Читать дальше