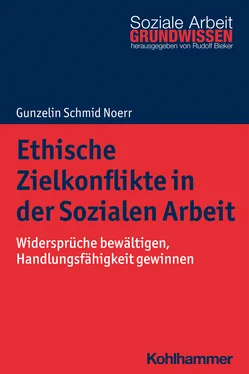1 ...7 8 9 11 12 13 ...18 Dabei handelt es sich um Zwangslagen, in denen man zwischen konkurrierenden oder konfligierenden, womöglich sich ausschließenden Handlungszielen zu wählen hat, die jeweils einen hohen ethischen Stellenwert einnehmen. Das bedeutet, dass man eines der Handlungsziele manchmal nur dadurch erreichen kann, dass man das andere verfehlt. Solche Strukturen können unterschiedlich bezeichnet werden:
• Spannungsverhältnis
Der Begriff ist eine Übertragung aus der Natur, in der unterschiedliche Kräfte gegeneinander wirken, wodurch bestimmte physische Effekte bewirkt werden, zum Beispiel elektrischer Strom. In psychischen und sozialen Bereichen geht es um ein Gegen- und Miteinander von Polaritäten jeglicher Art.
• Zielkonflikt
Er liegt dann vor, wenn zwei oder mehr Handlungsziele verfolgt werden sollen, die nicht gleichzeitig und im selben Umfang erreicht werden können. Ein Beispiel ist das »Magische Viereck« der liberalistischen Wirtschaftspolitik (hohe Beschäftigungszahl, Wachstum, Preisstabilität, außenwirtschaftliches Gleichgewicht).
• Widerspruch
Es gibt logische Widersprüche im Denken und Sprechen und, in übertragener Bedeutung, sachliche Widersprüche zwischen Menschen, Prozessen, Dingen. Bilden Widersprüche eine »höhere« Einheit, werden sie als »dialektischer« Widerspruch bezeichnet. Dabei entwickelt sich aus dem Widerspruch eine neue Einheit.
• Antinomie (wörtlich: Gegengesetzlichkeit, Widerspruch der Gesetzlichkeit mit sich selbst)
Ein Widerstreit, der aus zwei gegensätzlichen, jeweils für sich gut begründeten Allgemeinaussagen (Gesetzen) über denselben Gegenstand beruht.
• Dilemma (wörtlich etwa: zweifache Einnahme, Plural: Dilemmata, auch: Dilemmas)
Die Bedeutung des Ausdrucks hat sich im Lauf der Zeit vom Positiven zum Negativen verschoben: Man kann einen Nachteil nur vermeiden, indem man sich einen anderen einhandelt. In der Ethik steht er für eine Handlungssituation mit sich ausschließenden moralischen Anforderungen, deren Einlösung in beiden Fällen zu unerwünschten Nebenfolgen führt.
• Paradoxie (wörtlich: entgegen der Meinung)
Paradox in diesem Sinn sind zum Beispiel produktive wissenschaftliche Ergebnisse, die den üblichen Erwartungen widersprechen. Darüber hinaus werden damit sich widersprechende Sinngehalte bezeichnet, die jeweils für sich gut begründet sind. Und schließlich kann eine »Paradoxie« auch darin bestehen, dass man, in dem man konsequent ein bestimmtes Ziel verfolgt, dadurch am Ende gerade das Gegenteil erreicht – ob im Guten oder (zumeist) im Schlechten.
• Antagonismus (wörtlich: Gegeneinander-Handeln)
Der Widerstreit zweier Kräfte, Objekte oder Menschen. Zumeist ist ein feindseliges Verhältnis gemeint, seltener aber auch in neutraler Hinsicht ein Verhältnis des Gegenübers.
• Aporie (wörtlich: Ausweglosigkeit) Eine Aporie ist ein Problem, das mit den vorhandenen Mitteln nicht befriedigend gelöst werden kann. Die verschiedenen Lösungen, die sich anbieten, widersprechen sich. Man kann Aporien aufzeigen, um Adressaten über ihr NichtWissen aufzuklären, oder um nach neuen Wegen ihrer Auflösung zu suchen.
• Double-Bind (Doppelbindung)
Der Ausdruck bezeichnet eine bestimmte Kommunikationsstruktur mit zwei widersprüchlichen Botschaften des Inhalts- und des Beziehungsaspekts einer Mitteilung.
Die Liste ist nicht vollständig, andere, auch umgangssprachliche Bezeichnungen lassen sich hier nennen (Konflikt, Gegensatz, Zwickmühle, Kalamität, Verlegenheit o. ä.). Offensichtlich sind die Bezeichnungen, bei teilweise unterschiedlichen Konnotationen, nicht scharf gegeneinander abgegrenzt. Welche davon eignet sich am ehesten zur Analyse der hier fokussierten ethischen Orientierungs- und Entscheidungsprobleme? Einige der Bezeichnungen haben den Nachteil, dass bei ihnen negative Konnotationen vorherrschen (Dilemmata oder Aporien enthalten eher unerwünschte als erwünschte Alternativen). Bei anderen Bezeichnungen überwiegt der logische Aspekt gegenüber dem Praxisaspekt (Widerspruch, Paradox). Die Double-Bind-Kommunikation entfaltet ihre Problematik aufgrund einer Bindung, die im professionellen Handeln der Sozialarbeit normalerweise so nicht vorliegt. Im Begriff des Dilemmas wird die Situation unmittelbar auf die Entscheidung zwischen zwei Zielen zugespitzt, wodurch die Gefahr entsteht, mögliche Wege der Integration der Gegensätze oder die Suche nach Auswegen zu vernachlässigen.
So bietet sich als Oberbegriff, vor allem mit Bezug auf die professionelle Planung von Interventionen, der Begriff des Zielkonflikts an. Er bezieht sich nicht nur unmittelbar auf die einzelne Entscheidung und Handlung, sondern auch auf das hier in Frage stehende Gegen- und Miteinander der ethischen Werte in der Sozialen Arbeit. Nicht ausgeschlossen werden soll aber, dass hier gelegentlich auch andere der genannten Bezeichnungen verwendet werden, wenn ihre Konnotationen passend erscheinen.
1.5 Top-down und Bottom-up
Wie lassen sich nun diese Themenbereiche konzeptualisieren? Die ethische Reflexion der Sozialen Arbeit muss auf den philosophischen Ethikentwürfen der Geschichte und Gegenwart aufbauen. Dennoch kann sie nicht allein als Aufgabenstellung der Philosophie bestimmt werden. Die häufig vorkommende Rede von der Professionsethik als »angewandter Ethik« suggeriert, dass sich Erkenntnis als Einordnung des Besonderen in ein Modell der »allgemeinen Ethik« begreifen lasse.
Dass dies ungenügend ist, lässt sich an einem der bekanntesten allgemeinen Prinzipien aus der Geschichte der Ethik, Immanuel Kants »kategorischem Imperativ«, zeigen. Dessen Grundform lautet:
»Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.« (Kant [1785] 1996, 51)
Kant war der Ansicht, dies sei der fundamentale und letztlich einzige Grundsatz der Moral, mittels dessen sich alle moralischen Normen ableiten ließen. Der kategorische Imperativ ist selbst keine moralische Verhaltensregel, sondern ein Prüfinstrument für solche Regeln. Dabei ging es Kant allein um die Begründung allgemeiner Handlungsmaximen. Bei ihrer Anwendung auf die konkrete moralische Praxis verstrickte er sich jedoch in unhaltbare Positionen, so bei dem überkonsequenten Verbot zu lügen, das er an dem Beispiel demonstrierte, man müsse auch dann die Wahrheit sagen, wenn man von den gewaltsamen Verfolgern seines Freundes, den man eben versteckt habe, nach dessen Aufenthaltsort gefragt werde. Der Fehler besteht darin, dass Kant hier die besonderen Umstände des Falles, die tödliche Bedrohung des Flüchtenden, ausblendet und sich prinzipienethisch zur unhaltbaren Konsequenz eines unbedingten Ehrlichkeitsgebots entschließt.
Daraus kann man ersehen, dass die Top-down-Modellierung (von oben nach unten) von Erfahrungen immer auch auf die gegenläufige des Bottom-up (von unten nach oben) angewiesen bleibt. Wer sich mit der philosophischen Begründung ethischer Prinzipien befasst, weiß allein deswegen noch nicht viel über Richtigkeit und Falschheit, Wirkung und Tragfähigkeit konkreter Entscheidungen in arbeitsteilig organisierten Berufsfeldern. Auch wenn die Philosophie ethische Grundprinzipien begründen kann, kann sie nicht von außen oder oben her der Sozialen Arbeit verpflichtende Antworten auf ethische Fragen vorgeben. Andererseits aber gelingen ethische Fallanalysen nicht ohne Bezug auf allgemeine Prinzipien, denn nur mittels ihrer lassen sich verschiedene Fälle auf das ihnen Gemeinsame hin vergleichen. Zu entscheiden, ob ein einzelner Fall eine ethische Dimension hat und welche, setzt immer schon einen Vorbegriff der entsprechenden ethischen Kategorien voraus. Wer nicht eine Idee von Respekt hat, kann einen Fall von Respektlosigkeit gar nicht erst als solchen wahrnehmen.
Das Zusammenspiel von Top-down und Botton-up trägt dazu bei, dass sich die Soziale Arbeit angesichts des fortschreitenden gesellschaftlichen Wandels ethisch positioniert. Theorie und Praxis treffen sich gleichsam auf einer mittleren Ebene von Grundsätzen, die im Hinblick auf praktische Fragestellungen konkretisiert werden. Wie die individuellen ethischen Maximen sich lebensgeschichtlich als Kondensate von moralischen Erfahrungen und Gefühlen bilden, so bilden sich auch die professionsethischen Grundsätze als Abstraktionen von unterschiedlichen professionspraktischen Konstellationen.
Читать дальше