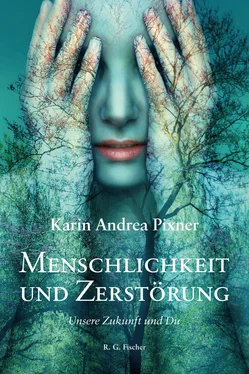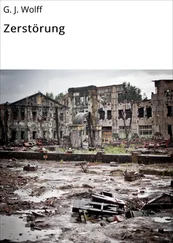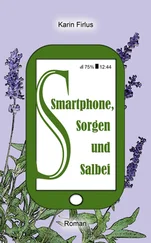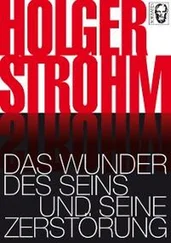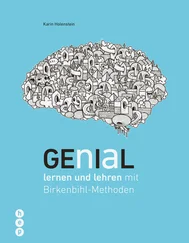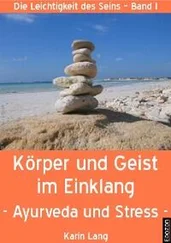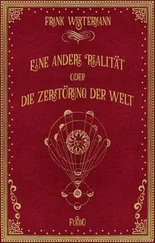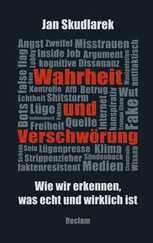Haben Sie auch Angst, so wie ich, »die alte Welt« zerbrechen zu sehen?
Hoffen Sie auch darauf, so wie ich, dass wir aus der Umwelt zerstörenden Lebensweise herauskommen?
Wünschen Sie sich auch, so wie ich, dass unsere Kinder und Enkelkinder in einer bewohnbaren, gesunden, menschlich friedlichen Zukunft leben können?
Wie vollziehen wir diesen Wandel in eine die Erde und Lebewesen erhaltende Lebensweise? Wie vollziehen wir dies trotz unserer menschlichen Prägungen, Ängste, Süchte? Und vor allem: Auf welche Weise können wir, Sie und ich und jeder Einzelne, uns jeden Tag einen Schritt in diese Richtung auf erfüllende und freudvolle Weise hin bewegen?
Bereits in meiner frühen Jugend besuchte ich Vorträge, die von den bevorstehenden ökologischen Katastrophen handelten und mit erhobenen Zeigfinger klar aufzeigten, was wir verändern müssen, wie wir anders leben müssen. Der Ton, in dem diese Vorträge gehalten wurden, war ein Angst machender, ein brisanter und dann ein klar wissender Ton, der vermittelte, warum es »dringend an der Zeit ist« und »dass wir einfach nur« dies beginnen oder das lassen sollten.
Vielleicht haben auch Sie schon mal so einen Vortrag gehört, wurden von ihm ergriffen, wie ich, wurden aufgeweckt, stimmten dem Redner zu. Die Art zu denken, die ich danach an mir bemerkte, war: »Oh ja, so muss ich nun handeln. Und so sollte ich nicht mehr handeln.« Diese Art berührte nicht wirklich mein Herz, machte Stress, hob mich in eine Sphäre der scheinbaren Sicherheit. »Wenn ich nur richtig handle, wenn wir alle nur richtig handeln, dann könnten wir die Krise, die Katastrophe hoffentlich noch abwenden.« Und: »Es ist kurz vor zwölf. Wir müssen uns nun wirklich verändern.«
Schon immer gab es da etwas Skeptisches in mir während der Vorträge sowie zu den Schlussfolgerungen. Ich konnte es nicht inhaltlich festmachen, da sich der Inhalt sehr schlüssig und logisch anhörte.
Was ließ mich skeptisch werden?
Ich fragte mich, warum sich die Redner und Rednerinnen in diesen Vorträgen so ins Zeug legen müssen, die Dringlichkeit, die Brisanz, das drohende Unglück für Erde, Lebewesen und Menschen darzustellen.
Sie scheinen zu einem Publikum zu sprechen, das sie überzeugen müssen, das nicht glauben oder wahrhaben will. Dies Publikum, das ihnen vor Augen zu steht, scheint begriffsstutzig zu sein, scheint faul und nicht willens zu sein. Warum hätten die Redner sonst so einen Stil verwendet?
Doch würde ein solches Publikum zu so einem Vortrag gehen, wenn es davon nichts wissen möchte, weil es nicht daran glaubt? Würde sich ein solches Publikum durch die Vehemenz der Schilderung umstimmen lassen, seine Verhaltensweisen ändern? Oder gehen sie von einer bestimmten Didaktik aus, wie uns Menschen beigebracht werden kann, endlich zur Einsicht zu gelangen und durch Einsicht, das Handeln und die Lebensweise zu ändern? Die Didaktik in so einem Fall würde darin bestehen,
—zunächst Angst zu machen, um
—durch die Angst aufzurütteln, aufzuwecken, zu motivieren,
—nun dringlich anders zu denken und anders zu handeln.
Als Erziehungswissenschaftlerin und Psychotherapeutin weiß ich mittlerweile, dass wir Menschen durch Angst bestenfalls konditioniert werden können, aber nicht nachhaltig tiefgreifende Lern- und Änderungsprozesse vollziehen können.
Wer von uns hat in der Schule etwas gut und tiefgreifend gelernt, wenn der Lehrer, die Eltern mit z. B. Nachsitzen oder schlechten Noten drohten?
Um wirklich etwas zu lernen, ist es notwendig, dass wir uns in Sicherheit erleben, dass wir uns gemocht und geliebt erleben. Dass wir selbst andere und das Leben lieben — kurz, dass wir uns im Erleben von »Das Leben ist in Ordnung und ich darin bin es auch« wiederfinden, öffnet den Raum zu tiefgreifenden Lern- und Veränderungsprozessen.
Wenn wir Menschen in Angst geraten, dann reduzieren sich schnell unsere Großhirnfunktionen. Wenn das geschieht, werden wir schnell in unseren Kompetenzen, klug, umsichtig und differenziert zu denken arg reduziert. Wir agieren aus einer Kombination von Reptilien-Gehirn und Gefühls-Gehirn. Auf diese Weise reduziert, können wir kaum noch komplexen, anderen Sichtweisen folgen, werden aggressiv, fühlen uns bedroht.
In der Angst sind wir geneigt, einen vielschichtigen Sachverhalt auf ein Täter-Opfer-Modell zu reduzieren. Warum?
Wenn ich z. B. Angst vor einer in Gang gekommenen Dynamik innerhalb einer Firma habe, die sogar meinen Arbeitsplatz gefährden kann, dann werde ich konfrontiert mit meiner Hilflosigkeit, mit Überforderung, mit Nicht-Wissen. Als ich mich als Studentin in so einer Dynamik in einer großen bayerischen Firma wiederfand, bemerkte ich, wie scheinbar hilfreich das sich anbietende Boot einer einfachen Erklärung war. Dies erzählte den Gefährdeten die Geschichte, dass es seit der Sohn des Geschäftsführers in die Firma gekommen war, »den Bach runter ginge«. Als diese Beobachtung verbreitet wurde, veränderte sich das Klima von Angst, Hilflosigkeit, Ohnmacht in Wut, Schimpftiraden und Empörung — kurz: Aus der passiven Haltung von »Wir können nichts tun« wurde die aktive Haltung von: »Wir wissen, woran es liegt und was zu tun wäre und sind wütend, wenn das nicht getan wird.«
Als damalige Psychologie-Studentin war ich bei Weitem nicht in der existenziellen Weise betroffen wie viele der Arbeitnehmer. Mir war bewusst, dass ich dadurch dies Geschehen leichter von außen beobachten konnte, ohne mit in den Strudel der hilflosen Empörung gerissen zu werden.
So konnte ich nachvollziehen, dass es bei vielen die Hoffnung gab, in aller Dringlichkeit und Emotionalität: Um das Unabwendbare abzuwenden, müsste einfach nur der Sohn des Geschäftsführers wieder die Firma verlassen. Dieser Lösungsansatz denkt kurzfristig und punktuell. Er denkt nicht in komplexen Zusammenhängen, die sich im Laufe der Zeit entwickeln.
Fühlen wir Menschen uns hilflos und unwissend in einer komplexen Bedrohungslage wieder, neigen wir, wie gesagt, zu den schnellen Lösungen. An diese sind wir bereit schnell zu glauben, zu hoffen, bis hin magisch zu denken. An diesen Glauben hängen wir uns mit aller Macht, verteidigen ihn, denn dieser Glaube bringt uns einen Erlöser, eine erlösende Lösung, die uns von all dem Unglück befreien kann.
Finden wir wie oben eine Person, »die an allem Schuld ist«, entlädt sich in diesem Ansatz all unsere Emotionalität. Diese Entladung hat eine so entspannende Wirkung, dass wir geneigt sind, diesen Ansatz als gut und wahr zu erachten. Langfristig hilfreiche Lösungen erachten wir als zu mühsam und uns zusätzlich belastend.
»Doch was ist«, so dachte ich mir damals, »wenn wir es wirklich nicht in der Hand haben, so große schicksalhafte Bewegungen abzuwenden wie möglicherweise die der Umweltkatastrophe? Was ist, wenn zwar jeder von uns einen Beitrag leisten kann (der natürlich Gewicht hat und wertvoll ist), wenn wir jedoch gleichzeitig in einer enormen Komplexität und Dynamik aller Lebewesen auf Erden und ihrem Zusammenwirken abhängig sind? Sind wir dann nicht auch gleichzeitig vergleichsweise klein — jeder Einzelne von uns und sogar wir als Menschheit?« In meinen Überlegungen habe ich mir damals die unzähligen Mikroorganismen (Pilze, Bakterien, usw.) vor Augen gehalten, die bei jedem Einzelnen das Essverhalten steuern, Partnerwahl, Entscheidungen treffen, als auch die Mikroorganismen, die auf dieser Erde leben. Wer bin ich, wenn mich so vieles steuert? Wer entscheidet schon allein nur in mir, was ich tue, esse, denke, wahrnehme?
Wie könnte es gelingen, mich sowohl bescheiden in dieser Kleinheit und Abhängigkeit wieder zu finden als auch meine Größe und Autonomie zu erleben, um handlungsfähig und hoffnungsvoll zu bleiben?
Wie könnte ich mich auf dieser Basis von Mitschwimmen-Müssen im großen Strudel der herannahenden Katastrophen für meine Handlungsfähigkeit, meine Lebensfähigkeit in einer erfüllenden Qualität interessieren?
Читать дальше