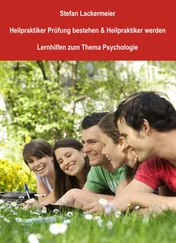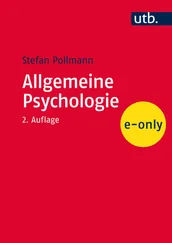Gestaltpsychologie
Als dritte bedeutsame Schule ist die Gestaltpsychologie zu nennen. Ihr Ausgangspunkt waren wahrnehmungspsychologische Untersuchungen und die Untersuchung von »Denkgestalten«. Hauptvertreter waren Ch. von Ehrenfels (1859 – 1932), Max Wertheimer (1880 – 1943), Kurt Koffka (1886 – 1941), Wolfgang Köhler (1887 – 1967) und Kurt Lewin (1890 – 1947). Das kennzeichnende Schlagwort für die Gestaltpsychologie lautet »Das Ganze (oder die Gestalt) ist mehr als die Summe seiner (ihrer) Teile«. Charakterisiert werden die Gestalten durch die Ehrenfels-Kriterien »Transponierbarkeit« und »Übersummativität«. Als Beispiel dient die Melodie: Ich erkenne sie auch in einer anderen Tonart. Ich höre nicht nur einzelne Töne, sondern eine »Gestalt«. In der Wahrnehmungslehre wandten sich die Gestaltpsychologen gegen die Auffassung, Wahrnehmungsgebilde seien aus atomhaften Empfindungen zusammengesetzt, also gegen den Atomismus und die »Elementenpsychologie«. Ebenso lehnten sie eine Vorstellungsmechanik (Gedanken als nur mechanisch-summative Verknüpfung von Vorstellungen) ab und wurden so zu Verbündeten der Würzburger Schule gegen die Assoziationstheorie (vgl. Müller 1971, S. 9).
Bedeutsam ist, dass »Gestalten« in einem »Feld« (einer Umgebung) eingebettet sind, das die Wahrnehmung beeinflusst, wie an einer Vielzahl von optischen Täuschungen nachgewiesen wurde.
Als kleines Beispiel diene die 9-Punkte-Aufgabe von Wertheimer.
| ● ● ● |
Diese 9 Punkte sind durch vier gerade Linien so zu verbinden, dass jeder Punkt getroffen wird. Der Bleistift ist nicht abzusetzen. |
|
| ● ● ● |
|
| ● ● ● |
|
Die Lösung gelingt, sobald die »Gestalt« des Quadrats durchbrochen wird.
Problemlösen, Denken, und Lernen sind also Produkte einer »Umstrukturierung« des Feldes. Nicht »trial and error«, Versuch und Irrtum im Sinne von Probieren führen zur Lösung, sondern Um-Organisation von Gestalten. Wolfgang Köhler postulierte denn auch ein »Lernen durch Einsicht«, das er den Affen in seinen Tierexperimenten zuschrieb, die Gegenstände ihrer Umgebung als Hilfsmittel benutzten, um an Futter zu gelangen, das Feld also im Sinne einer »guten Gestalt« (der Lösung der Aufgabe) umstrukturierten.
Anwendungen
Neben den mehr akademisch-theoretisch ausgerichteten Schulen etablierten sich in den 20er und 30er Jahren einige Institute, die sich auch praktischen Fragen zuwandten. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang:
William Stern
 Hamburg, wo ab 1920 William Stern (1889 – 1953) entwicklungspsychologische Studien betrieb (er gilt als »Erfinder« des Intelligenzquotienten; sein mit seiner Frau Clara herausgegebenes Buch über die Kindersprache, in dem die Beobachtungen an den eigenen Kindern Grundlage waren, war weit verbreitet).
Hamburg, wo ab 1920 William Stern (1889 – 1953) entwicklungspsychologische Studien betrieb (er gilt als »Erfinder« des Intelligenzquotienten; sein mit seiner Frau Clara herausgegebenes Buch über die Kindersprache, in dem die Beobachtungen an den eigenen Kindern Grundlage waren, war weit verbreitet).
Wilhelm Peters
 Jena, wo mit Wilhelm Peters (1880 – 1963) ein Entwicklungspsychologe Lehrstuhlinhaber wurde, der sich besonders der Lehrerausbildung widmete und zusammen mit Lehrern zahlreiche Testverfahren erprobte, und
Jena, wo mit Wilhelm Peters (1880 – 1963) ein Entwicklungspsychologe Lehrstuhlinhaber wurde, der sich besonders der Lehrerausbildung widmete und zusammen mit Lehrern zahlreiche Testverfahren erprobte, und
Charlotte und Karl Bühler
 Wien, wo Karl Bühler (1879 – 1963) und besonders seine Frau Charlotte Bühler (1893 – 1974) entwicklungspsychologische Forschung und pädagogische Erprobung in enger Zusammenarbeit mit pädagogischen Institutionen der Stadt praktizierten. Dabei entstand u. a. der noch heute teilweise verwendete Bühler-Hetzer-Entwicklungstest für Kinder.
Wien, wo Karl Bühler (1879 – 1963) und besonders seine Frau Charlotte Bühler (1893 – 1974) entwicklungspsychologische Forschung und pädagogische Erprobung in enger Zusammenarbeit mit pädagogischen Institutionen der Stadt praktizierten. Dabei entstand u. a. der noch heute teilweise verwendete Bühler-Hetzer-Entwicklungstest für Kinder.
1933
Für die deutsche Psychologie bedeutete die Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahre 1933 einen verheerenden Einschnitt. Teils mit Berufsverbot belegt, teils verfolgt, mussten die meisten der angesehenen Psychologieprofessoren ihre Lehrstühle räumen. Einige waren Juden, andere in politischer Opposition. Die meisten konnten emigrieren, nach den USA, Schweden oder England. Otto Selz, der letzte Vertreter der Würzburger Schule, ein Külpe-Schüler, entkam zunächst nach Holland und wurde von dort nach Auschwitz deportiert. Wenige der Emigrierten konnten ihre früheren Forschungsarbeiten fortsetzen, sie arbeiteten dort, wo man ihnen eine Stelle anbot. Eine neue Karriere starten konnten Charlotte Bühler, die sich der Therapie widmete und in den USA zu den Mitbegründern der Humanistischen Psychologie wurde, und Kurt Lewin (1890 – 1947), der die später sehr beachteten Experimente zur Wirkung von Erziehungsstilen auf das Gruppenverhalten von Kindern durchführte und sich sozialpsychologischen Fragen zuwandte.
Nach 1933 widmete sich die Psychologie in Deutschland, den gesellschaftlichen Umständen angepasst, vor allem den Feldern Typologie, Erbpsychologie und Rassenpsychologie. Eine Diskussion über diese Zeit hat erst spät begonnen. »Die Debatten an den Universitäten in den 60er Jahren zum Verhältnis der verschiedenen Disziplinen zum Nationalismus gingen an der Psychologie vorbei. Nichts wurde nach dem Krieg diskutiert, klammheimlich steckte man vielmehr Bereiche der Vergangenheit beiseite« (Ash/Geuter 1985, S. 173). In den Kriegsjahren wurden die psychologischen Institute geschlossen, ihre Mitarbeiter teils eingezogen, teils als Wehrmachtspsychologen (für Tauglichkeitsprüfungen und zur Auslese von Offiziersanwärtern) verwendet.
Neuanfang
Die Wiedereröffnung der Universitäten nach Kriegsende zeigte bei der Professorenschaft der Psychologie wenig Veränderung: Die meisten der vor dem Krieg Tätigen wurden übernommen, nur bekannt begeisterte Parteigänger wurden ausgeschlossen. Oswald Kroh (1887 – 1950), Philipp Lersch (1898 – 1972), Wilhelm Arnold (1911 – 1983) waren Vertreter der traditionellen Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie, wie sie bereits vor dem Kriege gelehrt wurde. Nach den Erfahrungen des »kollektiven Massenwahns« scheint es auch verständlich, dass die Pflege des Individuellen und die Würde der Person als Lehr- und Forschungsgegenstände populär wurden.
Rezeption internationaler Forschung
Ab 1950 etwa setzte sich ein neuer Trend durch, den man als die »Amerikanisierung« der Psychologie in der Bundesrepublik bezeichnen kann. Es war eine Zeit der Rezeption von Ideen, Methoden und Ansätzen, von denen die meisten zum Zeitpunkt ihrer Rezeption bereits zwei bis drei Jahrzehnte alt und in den USA längst sozial anerkannt waren. Doch waren diese Forschungen in Deutschland nicht bekannt gewesen. Erst durch jüngere Wissenschaftler, die als Stipendiaten in den USA studieren konnten und durch wenige, zögernd zurückkehrende Emigranten bekam man davon Kenntnis. Zudem sorgten von den Besatzungsmächten zur Verfügung gestellte Quellen (Bücher, Fachzeitschriften) für die Verbreitung vorher hier nicht bekannter Forschungsansätze.
Die Lernpsychologie, die Sozialpsychologie und die Klinische Psychologie (vorher weitgehend den Psychiatern überlassen) wurden übernommen. Die Forschungen wurden teilweise repliziert. Vor allem entstand ein großes Anwendungsfeld, in dem Beratungsstellen, Schulpsychologische Dienste und Therapiezentren eingerichtet wurden.
Obwohl man inzwischen von einer Internationalisierung der psychologischen Forschung sprechen kann, blieb die akademische Psychologie an den USA orientiert. Neben den Inhalten waren es vor allem die Methoden, die anfangs noch gegen den Widerstand der »Alten« übernommen wurden. Zum einen ging es um die Dominanz der Experimentalverfahren. Dass darüber gestritten wurde, so 1956 zwischen Peter R. Hofstätter (1913 – 1994), einem USA-Rückkehrer, und Albert Wellek (1904 – 1972), einem der dienst-ältesten deutschen Professoren damals, der auf »Intuition« als der wahren Methode zur Gewinnung psychologischer Erkenntnisse bestand, muss einen mit der Geschichte Vertrauten eigentlich wundern, waren doch die berühmten deutschen Schulen vor 1933 bereits sehr stark experimentell orientiert gewesen. Zum zweiten ging es in diesem Streit um den Wert statistischer Verfahren.
Читать дальше
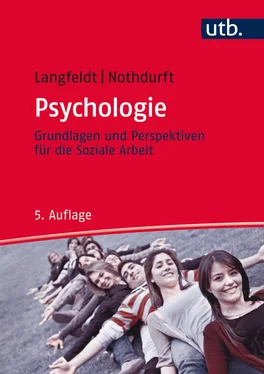
 Hamburg, wo ab 1920 William Stern (1889 – 1953) entwicklungspsychologische Studien betrieb (er gilt als »Erfinder« des Intelligenzquotienten; sein mit seiner Frau Clara herausgegebenes Buch über die Kindersprache, in dem die Beobachtungen an den eigenen Kindern Grundlage waren, war weit verbreitet).
Hamburg, wo ab 1920 William Stern (1889 – 1953) entwicklungspsychologische Studien betrieb (er gilt als »Erfinder« des Intelligenzquotienten; sein mit seiner Frau Clara herausgegebenes Buch über die Kindersprache, in dem die Beobachtungen an den eigenen Kindern Grundlage waren, war weit verbreitet).