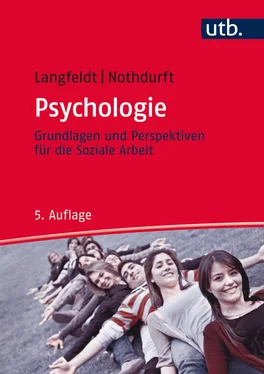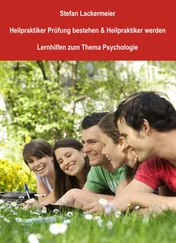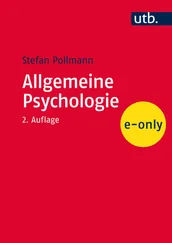4.4.3. Lernen als Verhaltensänderung: Nachahmen
4.4.4. Lernen als Wissenserwerb
4.5. Erzieherisches Verhalten
4.5.1. Typologie der Erziehungsstile
4.5.2. Dimensionen erzieherischen Verhaltens
4.5.3. Erziehungsziele und »Zeitgeist«
4.6. Ein Fall aus der Erziehungsberatung
5. Soziale Interaktion und Kommunikation
5.1. Geläufige Vorstellungen von Kommunikation
5.2. Zwei Sichtweisen auf Kommunikation
5.2.1. Ausdrucksmodelle von Kommunikation
5.2.2. Systemmodelle von Kommunikation
5.3. Dimensionen Sozialer Interaktion
5.3.1. Interaktive Bezogenheit des Handelns
5.3.2. Kontextuelle Gebundenheit der Bedeutung von Äußerungen und Handlungen
5.3.3. Prozessualität des interaktiven Geschehens
5.3.4. Materialität der Redebeiträge
5.4. Psychologische Aspekte Sozialer Interaktion
5.4.1. Identität
5.4.2. Denken und Erfahrung
5.4.3. Macht und Beeinflussung
5.5. Personenwahrnehmung
5.5.1. Personenwahrnehmung als Konstruktion – das Bild, das wir uns von anderen machen
5.5.2. Konstruktionsprinzipien der Personenwahrnehmung
5.5.3. Die Verschränkung von Selbst- und Fremdwahrnehmung
5.6. Einstellungen
5.6.1. Der Bauplan von Einstellungen
5.6.2. Die Funktionen von Einstellungen
5.6.3. Die Interaktionsdynamik von Einstellungen
5.7. Zuschreibung von Ursachen – Attribution in der sozialen Interaktion
5.7.1. Naive Analyse des Verhaltens
5.7.2. Attributionstendenzen
5.7.3. Attributionskomplexe – naive Theorien
5.8. Die soziale Gruppe als Interaktionskonstellation
5.8.1. Interaktionskonstellationen
5.8.2. Die treibende Kraft – Momente der Gruppendynamik
5.8.3. Prozess-Gestalten – Entwicklungsmuster in Gruppen
5.8.4. Sicherheit und Ordnung – Strukturbildung in Gruppen
6. Psychologische Diagnostik und Gutachten
6.1. Grundlagen psychologischer Diagnostik
6.1.1. Aufgaben, Ziele, Definition
6.1.2. Übersicht über diagnostische Datenquellen
6.2. Beobachtung und Beobachtungsprotokolle
6.3. Diagnostische Gesprächsformen: Anamnese und Exploration
6.4. Psychometrische Tests
6.4.1. Grundlagen und Überblick
6.4.2. Zwei Beispiele psychometrischer Leistungstests
6.4.3. Ein Beispiel für psychometrische Fragebögen
6.5. Projektive Tests
6.5.1. Grundlagen und Überblick
6.5.2. Zwei Beispiele projektiver Tests
6.6. Der diagnostische Prozess und das psychologische Gutachten
6.6.1. Der diagnostische Prozess
6.6.2. Beispiel eines Persönlichkeitsgutachtens
7. Psychologie der Intervention (Friedrich Ch. Sauter)
7.1. Psychotherapie als psychologische Intervention
7.2. Die Psychoanalyse – die erste Schule der Tiefenpsychologie
7.2.1. Vorgehen und Methode
7.2.2. Psychoanalytische Theorie zur Entstehung psychischer Störungen
7.2.3. Zusammenfassung
7.3. Verhaltenstherapie
7.3.1. Vorgehen und Methode
7.3.2. Theoretische Grundlagen der Verhaltenstherapie
7.3.3. Zusammenfassung
7.4. Klientenzentrierte Psychotherapie (Gesprächspsychotherapie)
7.4.1. Vorgehen und Methode
7.4.2. Theorie der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie
7.4.3. Bedingungen des therapeutischen Prozesses
7.4.4. Entstehung psychischer Störungen
7.4.5. Zusammenfassung
7.5. Indikation: Wer braucht eine Psychotherapie?
7.6. Evaluation und Wirkfaktoren der Psychotherapie
7.6.1. Wirkt Psychotherapie überhaupt?
7.6.2. Wie wirkt Psychotherapie?
8. Psychologische Aspekte sozialer Professionalität
8.1. Gesprächsgestaltung – am Beispiel von Beratungsgesprächen
8.1.1. Die Forderung nach kommunikativer Kompetenz
8.1.2. Eine Rahmentheorie kommunikativer Kompetenz
8.1.3. Anwendungsfeld: Beratungsgespräche
8.2. Selbst- und Fremdwahrnehmung – am Beispiel interkultureller Arbeit
8.2.1. Einführungsbeispiel: Eine gescheiterte Aussprache
8.2.2. Mechanismen der Eindrucksbildung und Personenwahrnehmung
8.2.3. Kulturelle Unterschiede in der Eindrucksbildung
8.2.4. Die Bedeutung interkultureller Arbeit für soziales Handeln
8.2.5. Fremde Welten vor Ort – Streetwork und Ethnographie von Jugendgruppen
8.3. Konfliktbewältigung – am Beispiel Mediation
8.3.1. Ein ganz normaler Konflikt
8.3.2. Schlichtung und Mediation
8.3.3. Ein Anwendungsbeispiel
8.4. Umgang mit Emotionen – am Beispiel der Betreuung von Sterbenden
8.4.1. Sozialpädagogen sind Gefühlsarbeiter
8.4.2. Hospiz als Ort des Sterbens
8.4.3. Sterbe-Begleitung als Grundkonzept für Gefühlsarbeit im Hospiz
8.5. Der Beitrag psychologischen Wissens für das Verständnis professioneller Praxis
Literatur
Sachregister
Vorwort zur fünften Auflage
Aufgrund der erfreulich großen Nachfrage nach diesem Buch wurde eine weitere, fünfte, Auflage erforderlich. Wir haben diese Gelegenheit genutzt, um Aktualisierungen vorzunehmen, kleine Textpassagen zu ergänzen und notwendige Korrekturen durchzuführen.
Das Buch hat über den engen Adressatenkreis der Studierenden hinaus eine rege Nachfrage gefunden und wir hoffen, dass es auch weiterhin für Personen in der Praxis attraktiv ist.
Dreieich und Fulda, im Februar 2015
Hans-Peter Langfeldt und Werner Pfab
Vorwort zur dritten Auflage
Dieses Buch erschien in der ersten und zweiten Auflage unter dem Titel Psychologie – Grundlagen und Perspektiven in der Reihe Studienbücher für Soziale Berufe. Aufgrund der großen Nachfrage wurde eine weitere Auflage erforderlich. Für diese Neuauflage wurde das Buch vollständig überarbeitet. Einige Kapitel wurden neu geschrieben, einige Kapitel erweitert und ergänzt, der gesamte Text kritisch durchgesehen und auf einen aktuellen Stand gebracht.
Mit dieser Neuauflage hat sich auch die Autorenschaft dieses Buches verändert. Es ist nunmehr von zwei Autoren geschrieben. Aufmerksame Leserinnen und Leser werden bemerken, dass wir beide Autoren durchaus etwas unterschiedliche Vorstellungen von Psychologie haben. Damit birgt ein solches Vorhaben das Risiko des Scheiterns. Dass statt dessen dieses Buchprojekt erfolgreich abgeschlossen werden konnte, betrachten wir als ein Beispiel gelungener Wissenschaftskultur mit ihren Grundwerten kritischer Auseinandersetzung und Toleranz. So wie wir die Zusammenarbeit an diesem Buch als persönliche Bereicherung erfahren haben, so hoffen wir, dass die unterschiedlichen Perspektiven und Akzente, die durch diese Zusammenarbeit in das Buch gelangt sind, auch von den Lesern und Leserinnen als Bereicherung und Horizonterweiterung erlebt werden.
Zum Zustandekommen dieses Buches haben aber nicht nur wir als Autoren beigetragen. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei den bisherigen Leserinnen und Lesern für ihr Interesse. Sie erst haben für den Erfolg gesorgt, der notwendig ist, um ein Buch erscheinen zu lassen. Wir bedanken uns ferner bei den »Gastautorinnen«, die einzelne Kapitel zu diesem Buch beigetragen haben. Außerdem bedanken wir uns bei Valentina Tesky und Esther de Waha, die mit großer Sorgfalt und Umsicht die redaktionelle Bearbeitung des Manuskripts besorgt haben.
Frankfurt am Main, Fulda, im März 2004
Hans-Peter Langfeldt und Werner Nothdurft
1. Einladung in die Psychologie
Jeder von uns hat im Laufe seines Lebens Vorstellungen darüber entwickelt, »wie die Menschen sind«, wie sie sich verhalten, wie sie ihr Zusammenleben gestalten und welche Schwierigkeiten dabei auftreten können.
Sehr häufig glauben wir zu wissen, warum die Beziehung eines uns bekannten Paares kriselt, warum die Kinder der einen Nachbarsfamilie so überaus schüchtern und die der anderen so aggressiv sind, warum ein Kollege so viele Schwierigkeiten am Arbeitsplatz hat und warum seine Frau immer so verhärmt aussieht.
Читать дальше