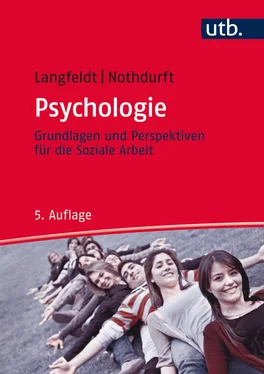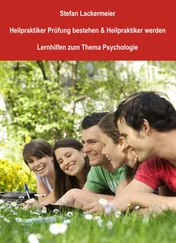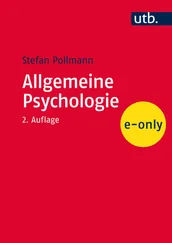Mittelalter
Die letzte Erkenntnis wird also nicht aus den Sinneserfahrungen gewonnen, sondern sie ist als Innewerden unveränderlicher Wahrheit göttlichen Ursprungs. Der Gedanke, dass der inneren Erfahrung einzig Gewissheit zukomme, dass ich an allem zweifeln könne, nur nicht daran, dass ich denke, nimmt das »cogito ergo sum« des Descartes (1596 – 1650) vorweg. Im 19. Jahrhundert greift Franz Brentano (1838 – 1917) mit seiner Bestimmung der »Intentionalität« des Psychischen wieder darauf zurück. Die Psychologie des Augustinus war bestimmend für das Mittelalter. Sie wurde weiter ausgeformt von Thomas von Aquin (1225 – 1274), den vor allem das Leib-Seele-Problem interessierte, also die Frage, wie Leib und Seele aufeinander wirken, wie die Verknüpfung vorgestellt werden kann, ob jeder Teil des Körpers beseelt sei.
Gegen Ende des Mittelalters (bzw. der Scholastik) wendet sich das Interesse von der bis dahin vorherrschenden Beschäftigung mit den Möglichkeiten des Erkennens dem Phänomen des Wollens zu. Duns Scotus (vor 1270 – 1308) und Wilhelm von Occam (um 1300 – 1349) betonen: Der Mensch ist in erster Linie ein wollendes Wesen. Wollen ist »radikale Spontaneität« (nach Hehlmann 1982, S. 55).
Neuzeit
Damit ist der Übergang zur Neuzeit eingeleitet, zur Renaissance, in der nun der »ganze Mensch« im Mittelpunkt des Interesses stand. Von psychologischem Interesse sind nun die Individualität, der Einzelmensch, die Charaktererfassung. Die Leidenschaften und Affekte werden nicht mehr als »niedrige Regungen«, die es zu unterdrücken gilt – wie im theologischen Kontext des Mittelalters – aufgefasst, sondern auch sie werden untersucht. Gelehrte Ärzte verfassen Abhandlungen zur Psychologie, so Paracelsus (1493 – 1541), der den Dualismus von Leib und Seele ablehnt und den Menschen als ganzheitliches Wesen, als Mikrokosmos betrachtet. Praktischen Fragestellungen (im heutigen Sinne) widmete sich schon Juan Huarte (um 1520 – 1589). In seinen Untersuchungen über die »Prüfung der Anlagen für die Wissenschaft« findet er humorale, klimatische und zerebrale Bedingungen für die Unterschiede in Begabung und Intelligenz und schließt pädagogische und eugenische Ratschläge an.
Die Zeit der Renaissance kann als Zeit der großen Horizonterweiterung betrachtet werden. Es war eine Zeit geographischer Entdeckungen, der Umwälzungen im Wirtschaftssystem (Einführung der Geldwirtschaft), der (eingeschränkten) sozialen Mobilität, des Aufblühens der Naturwissenschaften (Galilei, Newton), die in die Aufklärung mündete. Hier standen die Rechte des Individuums, vor allem in politischer Hinsicht, im Mittelpunkt des kämpferischen Interesses der Philosophen. Wieder geht es um die Erkenntnisfähigkeiten des Menschen, nun aber nicht mit Blick auf die Erkenntnismöglichkeit Gottes durch den Menschen, sondern auf seine Emanzipation und seine Freiheit. Die englischen Empiristen (Locke, Berkeley, Hume) betonen (im Anschluss an Aristoteles) den Primat der Erfahrung (nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu; nichts findet sich im Intellekt, was nicht vorher in den Sinnen war). Der Intellekt wird als »tabula rasa« beschrieben, der erst durch Sinneserfahrungen, Nachdenken (»Reflexion«) und durch Lernen gebildet wird.
19. Jahrhundert
Der Weg zur Psychologie, wie sie sich heute darstellt, wurde entscheidend geprägt durch das im Jahre 1871 erschienene Buch »Über die Abstammung des Menschen« von Charles Darwin (1809 – 1882). Der Mensch wird nun ganz und gar als Naturwesen gesehen. Damit scheinen auch alle seine Funktionen, Reaktionen und Erlebnisweisen mit den Methoden und Mitteln der Naturwissenschaften grundsätzlich erfassbar. Die »Seele« erweist sich als überflüssige Annahme. Dementsprechend propagiert C. G. Lange (1834 – 1900) eine »Psychologie ohne Seele«, ein mutiges Unterfangen, bedeutet »Psychologie« dem Wortsinne nach doch »Lehre von der Seele«.
experimentalpsychologische Schule
Im 19. Jahrhundert gibt es eine Fülle von psychologischen Ansätzen. An den Universitäten immer noch von Inhabern von Lehrstühlen der Philosophie vertreten, teilen sich die Interessen in traditionell geisteswissenschaftliche und experimentelle Psychologien. Die sich herausbildende experimentalpsychologische Schule lässt sich als physiologisch, evolutionär, atomistisch und quantifizierend beschreiben (vgl. Wertheimer 1970, S. 35). Ihre institutionelle 1879: Leipzig, erstes psychologisches Laboratorium W. Wundt Verankerung erfolgte im Jahre 1879, als Wilhelm Wundt (1832 – 1920) in Leipzig das erste experimentalpsychologische Laboratorium an einer deutschen Universität begründete (im gleichen Jahr wurde an der Harvard University durch William James das erste amerikanische Laboratorium eingerichtet, 1889 folgte die Sorbonne in Paris, 1894 das psychologische Institut in Graz, eingerichtet durch A. Meinong).
Auf diese Daten bezieht sich der eingangs zitierte Satz von Ebbinghaus. Philosophische Fragen wurden damals jedoch nicht ausgeklammert, wofür Wundt wie Brentano als Zeugen dienen können. Franz Brentano hatte 1874 seine Schrift »Psychologie vom empirischen Standpunkte« veröffentlicht, in der er seine These »Die Methode der Psychologie sei die der Naturwissenschaft mit Erfahrung als Grundlage« exemplifizierte. Er versuchte, der Psychologie ihren vollen Zuständigkeitsbereich zu retten, indem er zwei Teildisziplinen vorschlug: deskriptive und genetische Psychologie. Die genetische Psychologie sollte auf experimentellem Wege »das Seelenleben zergliedern«, die deskriptive Psychologie auf deduktivem Wege zu Theorien gelangen und die Ergebnisse allgemeingültig formulieren. Wundt dagegen wollte die experimentelle Methode nur auf elementare psychische Prozesse (etwa Messung von Empfindungsstärken) anwenden, »höhere« psychische Prozesse sind seiner Meinung nach der experimentellen Prüfung nicht zugänglich. Sie bedürften zur Erklärung hermeneutischer (geisteswissenschaftlicher) Verfahren.
Konsequenterweise wandten sich deshalb Wundts Schüler der experimentellen Forschung »einfacher Vorgänge« hauptsächlich aus dem Bereich der Sinnespsychologie zu. Unter Wundts Schülern gab es auch eine Reihe von Amerikanern, wovon der berühmteste E.B. Titchener (1867 – 1927) wurde, der die Wundtsche Psychologie in den USA bekannt machte.
Göttingen
Weitere Zentren entstanden in Göttingen, wo G.E. Müller (1850 – 1935) psychophysische Forschungen betrieb (er vertrat die Ansicht, dass jedem Berlin Psychischen ein Physisches entspreche) und in Berlin, wo H. Ebbinghaus seine bekannten Gedächtnisstudien betrieb. Ebbinghaus versuchte, die Länge der Gedächtnisspanne und die Gesetzmäßigkeiten beim Vergessen zu bestimmen, wozu er sich sinnarmer Silben als Material bediente.
Würzburger Schule
Eine erste große Kontroverse unter den »neuen« Psychologien entstand, als der Wundt-Schüler Oswald Külpe (1862 – 1915) mit seiner »Würzburger Schule« auch das Denken experimenteller Prüfung unterzog. Der herausragende Forscher dort war Karl Bühler (1879 – 1963), der der Frage nachging, »was erleben wir, wenn wir denken?« und seine Versuchspersonen anwies, in Selbstbeobachtung ihre Erlebnisse während der Lösung von Denkaufgaben genau zu beschreiben. Aufgrund der Auswertung der Ergebnisse kam Bühler zu dem Schluss, dass nicht mechanische Assoziationen (Verknüpfungen) von Vorstellungsinhalten das Denken ausmachen, sondern »reine Gedanken«, die unanschaulich sind. Die Problemlösung tritt als spezifisches »Aha-Erlebnis« auf (vgl. Bühler 1907). Wundt und seine Schule hielten diese Vorgehensweise für einen Missbrauch des Experiments (vgl. Ash/Geuter 1985, S. 51).
Am Rande soll noch vermerkt werden, dass es bei den damaligen Kontroversen nicht nur um sachliche oder methodische Fragen ging, sondern dass auch standes- und wissenschaftspolitische Interessen eine Rolle spielten. Die Philosophen fürchteten, dass durch die Zunahme an experimentalpsychologischer Ausrichtung die »eigentlichen« philosophischen Disziplinen wie Metaphysik, Erkenntnistheorie, Logik und Ethik in den Hintergrund gedrängt würden, dass »die großen Lebensfragen, die politischen, religiösen und sozialen Fragen« nicht mit Hilfe von Experimentalpsychologie zu lösen seien (Windelband zit. n. Ash/Geuter 1985, S. 52). Der Einwand war sicher nicht unberechtigt; letztlich förderte der Protest der Philosophen die institutionelle Trennung der Psychologie als eigene Disziplin von der Philiosophie.
Читать дальше