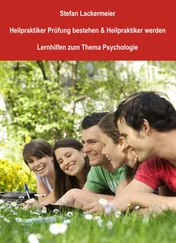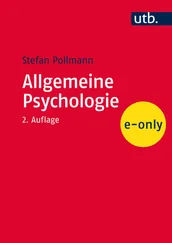Wir verbringen viel Zeit damit, uns über andere und deren Lebensweise Gedanken zu machen. Meistens sind wir auch davon überzeugt, dass wir in ähnlich schwieriger Lage uns anders, nämlich besser, verhalten würden.
Wir glauben auch zu wissen, wie wir wen »nehmen« müssen, wenn wir etwas erreichen wollen. Wenn wir gute Bekannte treffen, wissen wir, mit welchen Themen wir sie zum Schweigen oder Reden bringen können. Wir kennen ihre »kleinen Schwächen«.
Jeder von uns hat also ein mehr oder weniger deutlich ausgeprägtes Wissen, das sein Verhalten im Alltag prägt. Dieses psychologische Alltagswissen wird nicht nur durch den eigenen Umgang mit anderen Menschen erworben, sondern auch durch »indirekte« Erfahrung: Kunstwerke, Romane, Filme, Autobiographien und vieles mehr versorgen uns mit Wissen darüber, »wie die Menschen sind«. Unsere Sprache enthält viele Redensarten über menschliches Verhalten und Zusammenleben:
 Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.
 Was Du nicht willst, das Dir man tu’, das füg’ auch keinem andern zu.
Was Du nicht willst, das Dir man tu’, das füg’ auch keinem andern zu.
 Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.
Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.
 Früh krümmt sich, was ein Häkchen werden will.
Früh krümmt sich, was ein Häkchen werden will.
 Durch Schaden wird man klug.
Durch Schaden wird man klug.
Hinter solchen Redensarten verstecken sich alltagspsychologische Argumentationen, die über den konkreten Satzinhalt weit hinaus gehen. Sie können in sehr vielen unterschiedlichen Situationen eingesetzt werden und nicht selten widersprechen sie sich.
Mit Hilfe von psychologischem Alltagswissen verdeutlichen und erklären wir uns soziale Sachverhalte, schätzen die weitere Entwicklung ab und handeln entsprechend. Unsere psychologischen Alltagstheorien dienen so der Orientierung in sozialen Situationen und steuern unser Verhalten.
Ein kleines Beispiel: Nehmen wir an, Sie befinden sich nachts gegen halb ein Uhr in einer dunklen Straße auf dem Nachhauseweg. In der Ferne kommt Ihnen ein Mann torkelnd und lallend entgegen. Sie wissen aus Ortskenntnis, dass um die nächste Straßenecke eine Kneipe liegt, in der es häufiger schon zu Prügeleien kam. Vermutlich werden Sie nun annehmen, der entgegenkommende Mann sei betrunken. Möglicherweise halten Sie Betrunkene für unberechenbar und eher aggressiv. Weil Sie fürchten, angerempelt zu werden, wollen Sie einer Begegnung aus dem Wege gehen und wechseln die Straßenseite.
Anders sieht für Sie die Situation aus, wenn der torkelnde und lallende Mann sich erkennbar in Richtung der beleuchteten Notdienst-Apotheke bewegt. Möglicherweise glauben Sie jetzt, dass er Hilfe gebrauchen kann und gehen auf ihn zu.
Die meisten Menschen bewältigen ihre sozialen Schwierigkeiten oder persönlichen Krisen mit ihren eigenen Mitteln. Sie scheinen also durchaus effektive Alltagstheorien über soziale Sachverhalte zu besitzen. Diese Schlussfolgerung verführt leicht zur Auffassung, man könne auf eine wissenschaftliche Psychologie verzichten, da man von ihr nur höre, was man ohnehin schon wisse.
Tatsächlich kann man als Psychologe häufig die Erfahrung machen, dass Laien nach der psychologischen Erläuterung eines Sachverhaltes antworten: »Na und? Das habe ich schon immer gewusst!« (Langfeldt 1989) – Oder aber: »Das glaube ich nicht! So ist das nicht!« Laien neigen offensichtlich dazu, es immer schon oder gar besser zu wissen. Auf einem Kongress der wissenschaftlich tätigen Psychologen hat dies einmal zu folgender Klage geführt:
»Sie (die Psychologie, der Verf.) gehört ja zu jenen Gebieten, über die sich alle Welt rasch ein Urteil zutraut. Schließlich ist unsere Umgangssprache auch so ›vollgesogen‹ mit psychologischen Erklärungsmustern und Denkschemata, dass sich die Psychologisierung von Sachverhalten kaum vermeiden lässt, und es schwer fällt, nicht andauernd den Maßstab des psychologischen Vorverständnisses an die Welt (und damit auch an die wissenschaftliche Psychologie) anzulegen. Man achte nur einmal darauf, wie selbstverständlich Wörter wie ›motiviert‹, ›frustriert‹, ›aggressiv‹ etc. verwendet werden, so als ob damit ganz bestimmte reale Tatbestände erfasst wären, und nicht bloß auf psychologische Konstrukte Bezug genommen würde. Es ist deshalb eigentlich nicht erstaunlich, dass Laien meinen, auch Psychologen selbstverständlich darüber belehren zu können, wie ein bestimmtes Phänomen psychologisch zu erklären sei. Und tatsächlich gibt es ja kaum einen Juristen, dem nicht ein ganzes Arsenal psychologischer Theorien zu Gebote stünde, wenn es darum geht, Gründe dafür zu finden, weshalb jemand etwas Bestimmtes getan oder nicht getan hat. Da gibt es kaum einen Mediziner, kaum einen Architekten, kaum einen Literaturwissenschaftler, kaum einen Ökonomen, und eigentlich auch sonst niemanden, der nicht über die Motive handelnder Personen Bescheid wüsste. Wir stehen immer einer Mauer unerschütterlicher Vorverständnisse gegenüber, durch die vorgeformt ist, was als ›sinnvolle‹ und ›mögliche‹ psychologische Erklärung zu gelten hat und was nicht. Nicht wir sind die anerkannten Experten menschlichen Verhaltens, sondern alle anderen« (Foppa 1989, S. 6 – 7).
Spätestens jedoch, wenn man selbst unüberwindlich und hartnäckig in Schwierigkeiten geraten ist oder wenn man jemand anderen aus solchen Schwierigkeiten heraushelfen möchte, stellt sich heraus, dass man mit den eigenen Vorstellungen und Alltagstheorien nicht immer so erfolgreich ist, wie man es sein möchte. Scheinbar bewährte Rezepte, Strategien oder gar Tricks funktionieren nicht mehr. Dann ist psychologisches Wissen gefragt und notwendig, das solche Wege weist wie die wissenschaftliche Psychologie.
Wissenschaftliche Psychologie liefert Beschreibungen und Erklärungen für das Erleben und Verhalten von Menschen, die dazu beitragen sollen, das soziale Leben verstehbar zu machen. Das Ziel solcher Beschreibungen und Erklärungen ist es, sich selbst und andere genauer, angemessener und differenzierter wahrzunehmen und dadurch Handlungsräume zu erweitern und Probleme in neuem Licht sehen zu können.
Unter dieser Zielsetzung möchten wir in diesem Buch eine Einführung in psychologische Denkweisen über den Menschen geben und Sichtweisen zu wesentlichen Facetten des Erlebens und Verhaltens von Menschen vorstellen.
Das Nachdenken über das Erleben und Verhalten von Menschen hat eine lange Tradition, aus der sich die Psychologie als empirische Wissenschaft in ihrer heutigen Gestalt herausgebildet hat. Im zweiten Kapitel wird diese Tradition in ihren wichtigsten Linien nachgezeichnet, um dann deutlich zu machen, wodurch sich psychologische Erkenntnis von anderen Erkenntnisformen menschlichen Erlebens und Verhaltens unterscheidet und auszeichnet. Dabei wird sich zeigen, dass es im Bereich der Psychologie durchaus sehr unterschiedliche Auffassungen über die Gegenstände, Ziele und Vorgehensweisen psychologischer Erkenntnisgewinnung gibt.
Im Mittelpunkt psychologischer Betrachtung steht der Mensch – genauer: die menschliche Individualität. Im dritten Kapitel beschäftigen wir uns mit diesem Grundgedanken genauer. Zunächst wird deutlich gemacht, welchen Stellenwert der Gedanke individueller Persönlichkeit in unserer zivilisatorischen Entwicklung hat und wie es dazu gekommen ist. Danach werden verschiedene Betrachtungsweisen von Persönlichkeit vorgestellt, die in der Psychologie von besonderem Einfluss sind.
Читать дальше
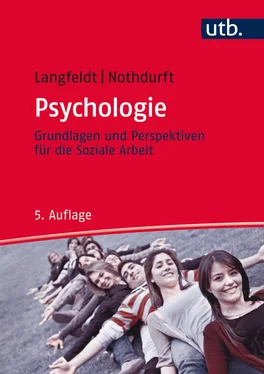
 Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.