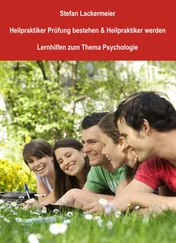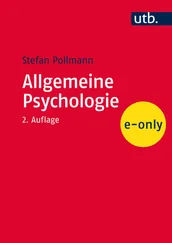kognitive Wende
Die Hochschätzung quantitativer Verfahren setzte sich durch, institutionell festzumachen an der ersten Tagung experimentell arbeitender Psychologen 1959 in Marburg. Die Ausklammerung des Subjekts aus der Psychologie, die Vermeidung mentalistischer Begriffe wie beispielsweise »Intentionalität«, konnte allerdings nicht durchgehalten werden. Die kognitive Wende oder gar kognitive Revolution, wie Herzog (1984) sagt, hat eine Neuorientierung bewirkt. Dies soll anhand der Motivationspsychologie illustriert werden.
Begriffe wie Wille oder Wollen waren zu Zeiten behavioristisch orientierter Forschung verpönt, zum einen, weil sie introspektiv zu erfassende Vorgänge darstellten, die mit der Methode der Fremdbeobachtung nicht zugänglich zu machen sind. Zum zweiten, weil der Wille den Aspekt der freien Entscheidung beinhaltet. Der sich frei entscheidende, der »autonome Mensch« war jedoch von Skinner zur Fiktion erklärt worden.
Miller, Galanter und Pribram veröffentlichten 1960 ihr Buch über »Plans and the structure of behavior«, in dem sie den Begriff »intention« als »unvollständige Teile eines Planes, dessen Ausführung gerade begonnen hat« einführten (Miller/Galanter/Pribram 1960, S. 61, Übers. d. Verf.). Handlung entsteht aus dem Zusammenwirken von »plans«, zu deren Bestandteilen »intentions« und »images« gehören, die als interne Repräsentationen charakterisiert werden (S. 7).
Attributionstheorie
Weitere Impulse erhielt die kognitionspsychologische Richtung durch die Attributionstheorie. Ausgangspunkt war 1958 Fritz Heiders Buch »The Psychology of Interpersonal Relations« (deutsch 1977), in dem er den Alltagsmenschen zum Gegenstand der Psychologie machte. Seine Erforschung sogenannter naiver Konzepte und Erklärungsmodelle wies in eine neue Richtung, die sich in Deutschland beispielsweise im »Forschungsprogramm Subjektive Theorien« (Groeben/Wahl/Schlee/Scheele 1988) durchgesetzt hat.
Heider
Heider, der bei Meinong in Graz promoviert hatte, in Berlin bei Stern Assistent gewesen war, dort mit Kurt Lewin und Max Wertheimer, später in den USA wieder mit Lewin zusammengearbeitet hatte, ist den gestalt- und feldtheoretischen Ansätzen verbunden. Sein Ansatzpunkt geht jedoch über Lewin hinaus. Erklärte Lewin Verhalten als Funktion von Person und Umwelt, so verändert Heider den Aspekt. Anders als Lewin bezieht er sich nicht auf die tatsächlichen, auf eine Person einwirkenden psychologischen Kräfte und Verhaltensdeterminanten, sondern auf die wahrgenommenen Ursachen von Verhalten; die wahren und die wahrgenommenen Verhaltensursachen müssen keineswegs identisch sein. Mit der Betonung der »wahrgenommenen« Ursachen spricht Heider nichts anderes an als den Vorgang der »inneren Wahrnehmung« im Sinne von Meinong und Brentano. So lässt sich also für diese Zeit (dem allmählichen Aufkommen der Kognitionspsychologie) mit Pinker (1998, S. 110) feststellen:
»Bevor Newell und Simon sowie die Psychologen George Miller und Donald Broadbent in den fünfziger und sechziger Jahren Ideen aus der Computertechnik aufgriffen, war die Psychologie nur langweilig. Ihr Studiengang bestand aus physiologischer Psychologie (das heißt Reflexe) und Wahrnehmung (das heißt Piepser), Lernen (das heißt Ratten), Gedächtnis (das heißt sinnlose Silben), Intelligenz (das heißt IQ) und Persönlichkeit (das heißt Tests). Seitdem hat die Psychologie viele Fragen der klügsten Denker der Menschheitsgeschichte ins Labor geholt und Tausende von Entdeckungen gemacht, die alle Aspekte des Geistes betreffen.« Kluwe (2001, S. 1) hält diese Einschätzung »bezüglich der Entwicklung nach 1960 auch für den deutschsprachigen Raum für zutreffend.«
Neben der Kognitionspsychologie, die Wissen und Denken, Sprache und Textverarbeitung, Motivation und Handlung untersuchte, etablierten sich die Biologische Psychologie (Pinel/Pauli 2007) und die Neuropsychologie, denn die Kognitionswissenschaft ist mit ihrem Modell vom Menschen als Informationsverarbeiter analog zum Computer wiederum an Grenzen gestoßen (man denke an die Rolle von Emotionen und von genetischen Einflüssen).
Neue technische Geräte und Analyseverfahren bieten in der Hirnforschung bisher unbekannte Zugangsweisen.
Die Forschungs- und Anwendungsbereiche der Psychologie in Deutschland vom Ende des vorletzten Jahrhunderts bis heute lassen sich gut nachvollziehen anhand der Berichte, die die jeweiligen Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Psychologie »Zur Lage der Psychologie« im zweijährigen Turnus anlässlich der Kongresse der Gesellschaft vorlegen. Begonnen hat diese Tradition Carl F. Graumann im Jahre 1970 (Graumann 1973, S. 19 – 37).
Zunächst hat sich die Zahl der Psychologischen Institute deutlich erhöht: von 18 im Jahre 1961 auf 49 im Jahre 2013; die Anzahl der Professoren stieg in diesem Zeitraum von 17 auf 719, die der Studierenden von 2500 auf 44 000.
Bemerkenswert ist die Steigerung des Frauenanteils unter den Studierenden auf 82 % (2010), geschuldet z. T. der NC-Regelung als Zugangsvoraussetzung. Bei Promotionen (68,2 %) und Habilitationen (45,2 %) wird der Effekt wieder nivelliert. (Frensch 2013)
Eine zeitgeschichtliche Besonderheit stellte die Vereinigung Deutschlands dar. In der Psychologie wurde, wie in vielen anderen akademischen Disziplinen, die Forschungs- und Ausbildungsrichtung der Bundesrepublik exportiert. Eigenständige Traditionen der DDR, auf die hier nicht eingegangen werden kann, (Bredenkamp 1993, S. 17f.; Sprung/Sprung 1999, S. 135; Ettrich 2005) wurden abgelöst.
2.2. Was ist eigentlich Psychologie?
2.2.1. Eine Annäherung
Spätestens nach der geschichtlichen Beschreibung der Psychologie wird bei manchem Leser oder mancher Leserin eine Frage (wieder) auftauchen, die bisher zurückgestellt wurde: »Was ist Psychologie eigentlich für eine Wissenschaft?« Leider ist die Antwort nicht so selbstverständlich wie die Frage.
Eine mögliche Antwort könnte aus dem geschichtlichen Rückblick gewonnen werden. Dieser zeigt jedoch, dass der Gegenstand der Psychologie zu keiner Zeit einheitlich war. Das, was Psychologie als Wissenschaft ist, war stets von den vorherrschenden Menschenbildern abhängig. Diese verändern sich im Laufe der gesellschaftlich-geschichtlichen Entwicklung. Die Antwort müsste lauten: Psychologie selbst ist veränderlich und lässt sich nicht festlegen.
Man könnte eine Antwort aber auch durch das Studium anerkannter Lehrbücher für Psychologen (z. B. Schönpflug 2006, Gerrig/Zimbardo 2008) finden. Schließlich müssen Psychologen selbst doch wissen, was Psychologie ist oder sein soll. Psychologie ist dann einfach das, was in anerkannten Lehrbüchern steht.
Für jemanden, der gerade beginnt, sich in ein neues Wissensgebiet einzuarbeiten, klingen diese beiden Antworten wohl nicht sehr ermutigend. Vollends zynisch muss es dem Laien vorkommen, wenn ihm mit Hinweis auf sein »falsches« Verständnis von Wissenschaft die Antwort einfach verweigert wird (z. B. Groeben/Westmeyer 1981, S. 13).
Allgemeine Definition
Im Sinne einer Annäherung ist eine vorläufige, allgemeine Charakterisierung sinnvoll, um einen Einstieg in eine genauere Beschäftigung mit dem Wissenschaftsgebiet Psychologie zu erleichtern:
 Psychologie versteht sich als Wissenschaft, die alle Phänomene des Erlebens und Handelns von Menschen zu beschreiben, zu erklären, zu verstehen und zu beeinflussen sucht.
Psychologie versteht sich als Wissenschaft, die alle Phänomene des Erlebens und Handelns von Menschen zu beschreiben, zu erklären, zu verstehen und zu beeinflussen sucht.
 Psychologie versteht sich primär als empirische Wissenschaft, d. h. als eine Wissenschaft, die ihre Erkenntnisse auf der Grundlage systematisch gewonnener Erfahrungen formuliert.
Psychologie versteht sich primär als empirische Wissenschaft, d. h. als eine Wissenschaft, die ihre Erkenntnisse auf der Grundlage systematisch gewonnener Erfahrungen formuliert.
Читать дальше
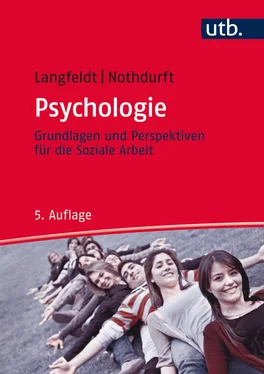
 Psychologie versteht sich als Wissenschaft, die alle Phänomene des Erlebens und Handelns von Menschen zu beschreiben, zu erklären, zu verstehen und zu beeinflussen sucht.
Psychologie versteht sich als Wissenschaft, die alle Phänomene des Erlebens und Handelns von Menschen zu beschreiben, zu erklären, zu verstehen und zu beeinflussen sucht.