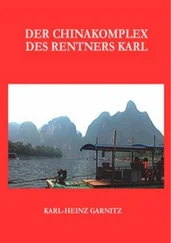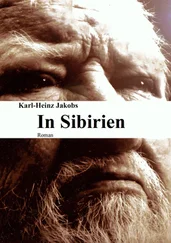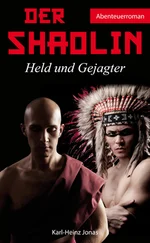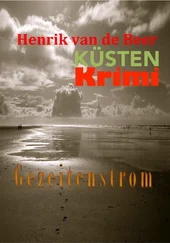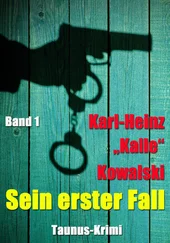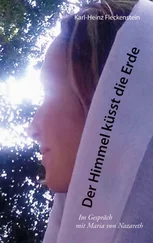Künstler der Moderne wie Joseph Beuys in seiner Rauminstallation „Das Ende des 20. Jahrhunderts“ (1983) oder in seiner Zeichnung „selbst im Gestein“ (1955), oder Walter Dahn in seinem Bild „Selbst doppelt“ (1982) bestätigen: Die Spaltung, die Zerrissenheit, die Exkorporalisierung des Menschen der Moderne ist allenfalls in ihrer Unversöhnlichkeit zu illustrieren (Menzen 1990a). Die ursprungsmythologische Tendenz, Kunst- und Naturausdruck des Menschen gleichzusetzen, wird von den Kritikern da zurückgewiesen, wo die Eigenständigkeit des Kulturellen, des spezifisch Künstlerischen verloren geht.
Seit den 1960er Jahren des 20. Jahrhunderts hat sich eine Version tiefenpsychologisch und analytisch orientierter Gestaltungstherapie aufgetan (Kramer 2014; Franzke 1977; Wellendorf 1984; Schrode 1989; Schottenloher 1989). Sie versteht sich „als Therapie mit bildnerischen Mitteln auf tiefenpsychologischer Grundlage“ (so der Titel von Schrode 1989) und hat vor allem in die klinisch-stationäre Gruppenpsychotherapie Eingang gefunden (Petzold 1987). Gestaltungstherapie solcher Art sieht sich als Ergänzung verbal orientierter Psychotherapie durch den bildnerischen Ausdruck. Sie beabsichtigt die spontane Ausdrucksgestalt als eine Synthese von Innerem und Äußerem und intendiert die Vermittlung zwischen Bewusstem und Unbewusstem in der symbolisch sich entwickelnden Äußerung (Jung 1958 / 1916). Gestaltungstherapeutische Verfahren werden beispielsweise bei Menschen mit Borderline-Syndrom, mit posttraumatischen Störungen und unterschiedlichsten psychoneurotischen und psychovegetativen Störungen angewandt, sowohl in privater wie in klinisch-stationärer Praxis, besonders in der medizinisch-stationären Rehabilitation.
1.6 Der tiefenpsychologische Ansatz
Ein spezifisch tiefenpsychologischer und psychotherapeutischer Ansatz der Kunsttherapie stimmt mit dem zuletzt beschriebenen teilweise überein: Er fußt auf Freuds These, dass sich im jeweiligen symbolischen Ausdruck ein Triebschicksal offenbare. Ebenso greift er Jungs Antwort auf, dass diese These allzu leicht auf die kindliche Triebgeschichte reduziert werden könne und komplexer gesehen werden müsse. Mit Jung wird angenommen, dass der Sinn des Symbols in dem Versuch besteht, das noch gänzlich Unbekannte und Werdende analogisch zu verdeutlichen. Die Erkenntnis von Freud und Jung war, dass sich im Vorgang des Symbolisierens seelische Konflikte ästhetisch-bildnerisch dokumentieren können. Beide vermuteten, dass sich hinter dieser Stellvertretung ein affektbeladener, verhientnderter seelischer Vorgang verbirgt, der eine andere Entladung (Konversion), eine Umleitung und ein Abschwellen der Erregung sucht (Katharsis). Der symbolisch angedeutete Sinnzusammenhang weise auf einen abgewehrten Ausdruck zurück. Und das Unbewusste, so Jung, entwerfe im Symbol eine Vorstellung dessen, was eigentlich gemeint sei und was nach Bewusstwerdung, nach Gestaltung dränge (Dieckmann 1972).
Freudianische und jungianische Positionen haben das Dokument des Unbewussten unterschiedlich diskutiert: Freuds Anhänger konzentrieren sich auf die Semantik, die Bedeutung des symbolischen Ausdrucks, und suchen die Ursachen in der frühen Triebgeschichte. Vertreter der jungschen Auffassung rücken den Sinnzusammenhang des individuellen Lebenswegs insgesamt in den Mittelpunkt. In der Nachfolgediskussion sind die Ziele des ästhetischen Produzierens, des ästhetischen Gestaltens entsprechend unterschiedlich: Es soll zur Regression anregen und ermöglichen, auf eine frühere, unzensierte, emotionalere Stufe der psychogenetischen Entwicklung zurückzugehen (Kris 1977). Die Differenzierung von Denk- und Bewusstseinsstrukturen soll außer Kraft gesetzt werden (Müller-Braunschweig 1964; Ehrenzweig 1974). Die ästhetische Produktion soll verdrängte Affekte freisetzen, eine Bewältigung von Konfliktspannungen durch Reduktion und Abfuhr von Triebenergie (Katharsis) in die Wege leiten und solchermaßen eine libidinöse Entlastung herbeiführen (Müller-Braunschweig 1977). Angstbesetzte Vorstellungen sollen in eine äußere bildnerische Realität überführt werden (Fenichel 1983). Das ästhetische Gestalten ermöglicht den Austausch des Triebobjekts bei Beibehaltung der Triebziele (Sublimation) und hilft dadurch, nicht-sozialisierte Impulse zu bewältigen (Schmeer 1995). Es soll im Sinn narzisstischer Regulation zum affektiven Gleichgewicht, zur Erweiterung der Ich-Grenzen beitragen (Henseler 1974; Benedetti 1979). Und es soll u. U. ein Probehandeln sein, um das, was sonst nicht möglich, nicht erlaubt ist, zu agieren (Müller-Braunschweig 1974; Schuster 1997).
Der tiefenpsychologische Ansatz der Kunsttherapie wird in privater und klinischer Praxis verwandt und ist dabei, sich mit anderen, beispielsweise verhaltens-, familien- und systemtherapeutischen Ansätzen zu liieren (Schmeer 1995; Menzen 1999; Schmeer 2006 a, b).
2 Zur Aktualität der künstlerischen Therapieformen
Die Kunsttherapie unserer Tage wird im klinisch-psychologischen und im rehabilitativen Bereich eingesetzt, und zwar stationär, ambulant und komplementär. Sie macht sich die innerpsychischen Prozesse bei der Betrachtung und bei der Herstellung von bildnerischen Ausdrücken zunutze. Ihr Zweck besteht darin, die Orientierungs- und Gefühlslagen der Patienten wiederherzustellen und Problem- wie Leidenssituationen bildnerisch zu bearbeiten. Ihr Mittel besteht darin, jenen psychischen Ausdrücken, jenen Bildern, Vorstellungsmustern, die Leiden verursachen, eine andere Ausrichtung zu geben. Im Ergebnis sollen die Bewusstseins- und Erlebnisweisen, aber auch die Verhaltensabläufe mit bildnerischen Mitteln so konstelliert werden, dass es möglich wird, das Alltagsleben neu zu sehen und zu bewältigen.
Drei praktische Perspektiven der Kunsttherapie haben sich herausgeschält – eine klinisch-neurologische und heilpädagogische-rehabilitative, eine psychosomatisch-tiefenpsychologische und eine psychiatrisch orientierte Kunsttherapie. Alle drei Perspektiven werden derzeit in der sozial- und heilpädagogisch- wie psychotherapeutisch-medizinischen Rehabilitation angewandt.
 Die klinisch-neurologische und heilpädagogische-rehabilitative Kunst-therapie sucht vor allem die Selbsterlebens- und Erfahrensformen des geistig und körperlich behinderten oder dementen Menschen zu restituieren oder zu kompensieren; und dazu bedarf es einer langwierigen Wiederaneignung der unterbrochenen Sozialisation. Jeder, der täglich mit geistig behinderten und / oder neurologisch geschädigten Menschen zu tun hat, kennt die Etikettierungen, denen diese ausgesetzt sind. Was der Therapeut über diese Menschen denkt, wie er sie wahrnimmt und wie er ihre Kompetenzen und Defizite einschätzt, das bleibt den Betroffenen in der Regel verborgen. Sie scheinen in ihrer eigenen Welt zu leben, die den Außenstehenden eine terra incognita ist. Der therapeutische Prozess, der in den Umkreis dieser Welt eindringt, entwickelt sich in bildnerischen, psychologisch und physiologisch angemessenen Schritten. Er knüpft dabei mit den Mitteln der Kunst an den Facetten der bildnerischen Material-, Form- und Farbgebung an, deren je eigene Psychodynamik aus den erstarrten, zuweilen nie erlebten Verhaltens- und Bewusstseinsformen herausführen soll (Menzen 2007, 355–368).
Die klinisch-neurologische und heilpädagogische-rehabilitative Kunst-therapie sucht vor allem die Selbsterlebens- und Erfahrensformen des geistig und körperlich behinderten oder dementen Menschen zu restituieren oder zu kompensieren; und dazu bedarf es einer langwierigen Wiederaneignung der unterbrochenen Sozialisation. Jeder, der täglich mit geistig behinderten und / oder neurologisch geschädigten Menschen zu tun hat, kennt die Etikettierungen, denen diese ausgesetzt sind. Was der Therapeut über diese Menschen denkt, wie er sie wahrnimmt und wie er ihre Kompetenzen und Defizite einschätzt, das bleibt den Betroffenen in der Regel verborgen. Sie scheinen in ihrer eigenen Welt zu leben, die den Außenstehenden eine terra incognita ist. Der therapeutische Prozess, der in den Umkreis dieser Welt eindringt, entwickelt sich in bildnerischen, psychologisch und physiologisch angemessenen Schritten. Er knüpft dabei mit den Mitteln der Kunst an den Facetten der bildnerischen Material-, Form- und Farbgebung an, deren je eigene Psychodynamik aus den erstarrten, zuweilen nie erlebten Verhaltens- und Bewusstseinsformen herausführen soll (Menzen 2007, 355–368).
 Die psychosomatische, zunehmend traumatherapeutisch orientierte Kunsttherapie will helfen, dass das Selbsterleben des beschädigten, des regressiven Bewusstseins, das sich leidvoll am Körper zeigt, bildnerisch ausgedrückt und dadurch aus Erstarrungen gelöst werden kann. Setting und Interventionsformen gleichen zuweilen noch denjenigen der Psychoanalyse, werden aber immer mehr von den explorativen Imaginationsverfahren und der Verhaltenstherapie geprägt. Ihr geht es einmal um die innere wie die äußere Form des Erlebten und dessen bildnerische Darstellung. Das Erlebte soll beispielsweise in der traumatherapeutischen Behandlung nach einer Phase der Stabilisierung in der sog. Traumaexposition eine Form, eine Gestalt erhalten – und so anschaubar, reflektierbar, auf die nicht mehr leiden machenden Seiten, eher auf die den Patienten eigenen Ressourcen hin ausgerichtet werden. Ihr geht es einerseits darum, die leiden machenden, immer wiederkehrenden Bilder, die schädlichen Erlebens- und Verhaltensmuster transparent, fassbar zu machen, andererseits die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Die psychosomatisch orientierte Kunsttherapie hat viel von der Gestalttherapie gelernt, die die inneren Beweggründe, die krankmachend sind, nachzuvollziehen, auszugestalten sucht, um sich schließlich der eigenen Kompetenzen bewusst zu werden.
Die psychosomatische, zunehmend traumatherapeutisch orientierte Kunsttherapie will helfen, dass das Selbsterleben des beschädigten, des regressiven Bewusstseins, das sich leidvoll am Körper zeigt, bildnerisch ausgedrückt und dadurch aus Erstarrungen gelöst werden kann. Setting und Interventionsformen gleichen zuweilen noch denjenigen der Psychoanalyse, werden aber immer mehr von den explorativen Imaginationsverfahren und der Verhaltenstherapie geprägt. Ihr geht es einmal um die innere wie die äußere Form des Erlebten und dessen bildnerische Darstellung. Das Erlebte soll beispielsweise in der traumatherapeutischen Behandlung nach einer Phase der Stabilisierung in der sog. Traumaexposition eine Form, eine Gestalt erhalten – und so anschaubar, reflektierbar, auf die nicht mehr leiden machenden Seiten, eher auf die den Patienten eigenen Ressourcen hin ausgerichtet werden. Ihr geht es einerseits darum, die leiden machenden, immer wiederkehrenden Bilder, die schädlichen Erlebens- und Verhaltensmuster transparent, fassbar zu machen, andererseits die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Die psychosomatisch orientierte Kunsttherapie hat viel von der Gestalttherapie gelernt, die die inneren Beweggründe, die krankmachend sind, nachzuvollziehen, auszugestalten sucht, um sich schließlich der eigenen Kompetenzen bewusst zu werden.
Читать дальше
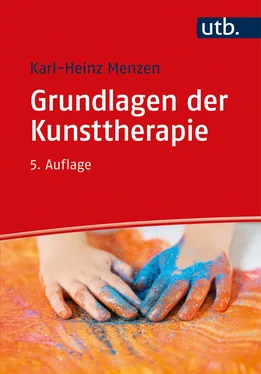
 Die klinisch-neurologische und heilpädagogische-rehabilitative Kunst-therapie sucht vor allem die Selbsterlebens- und Erfahrensformen des geistig und körperlich behinderten oder dementen Menschen zu restituieren oder zu kompensieren; und dazu bedarf es einer langwierigen Wiederaneignung der unterbrochenen Sozialisation. Jeder, der täglich mit geistig behinderten und / oder neurologisch geschädigten Menschen zu tun hat, kennt die Etikettierungen, denen diese ausgesetzt sind. Was der Therapeut über diese Menschen denkt, wie er sie wahrnimmt und wie er ihre Kompetenzen und Defizite einschätzt, das bleibt den Betroffenen in der Regel verborgen. Sie scheinen in ihrer eigenen Welt zu leben, die den Außenstehenden eine terra incognita ist. Der therapeutische Prozess, der in den Umkreis dieser Welt eindringt, entwickelt sich in bildnerischen, psychologisch und physiologisch angemessenen Schritten. Er knüpft dabei mit den Mitteln der Kunst an den Facetten der bildnerischen Material-, Form- und Farbgebung an, deren je eigene Psychodynamik aus den erstarrten, zuweilen nie erlebten Verhaltens- und Bewusstseinsformen herausführen soll (Menzen 2007, 355–368).
Die klinisch-neurologische und heilpädagogische-rehabilitative Kunst-therapie sucht vor allem die Selbsterlebens- und Erfahrensformen des geistig und körperlich behinderten oder dementen Menschen zu restituieren oder zu kompensieren; und dazu bedarf es einer langwierigen Wiederaneignung der unterbrochenen Sozialisation. Jeder, der täglich mit geistig behinderten und / oder neurologisch geschädigten Menschen zu tun hat, kennt die Etikettierungen, denen diese ausgesetzt sind. Was der Therapeut über diese Menschen denkt, wie er sie wahrnimmt und wie er ihre Kompetenzen und Defizite einschätzt, das bleibt den Betroffenen in der Regel verborgen. Sie scheinen in ihrer eigenen Welt zu leben, die den Außenstehenden eine terra incognita ist. Der therapeutische Prozess, der in den Umkreis dieser Welt eindringt, entwickelt sich in bildnerischen, psychologisch und physiologisch angemessenen Schritten. Er knüpft dabei mit den Mitteln der Kunst an den Facetten der bildnerischen Material-, Form- und Farbgebung an, deren je eigene Psychodynamik aus den erstarrten, zuweilen nie erlebten Verhaltens- und Bewusstseinsformen herausführen soll (Menzen 2007, 355–368).