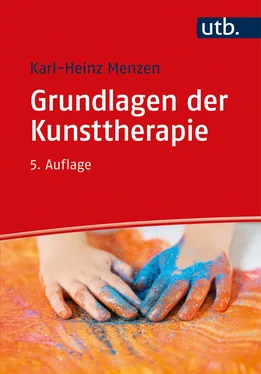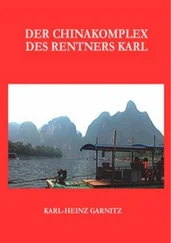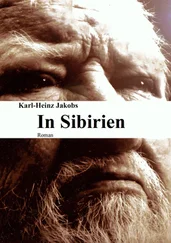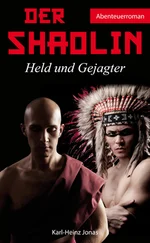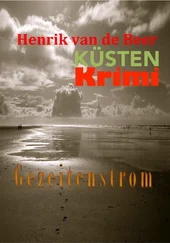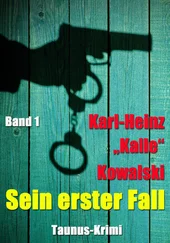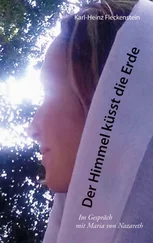4 Der Beruf „Kunsttherapeut / in“ mit dem Schwerpunkt der klinischen Rehabilitation
4.1 Kunsttherapie in der Rehabilitation
4.2 Rehabilitationskliniken und kunsttherapeutische Maßnahmen
Schlussbemerkung: Von der Kunst, mit Leiden wortlos umzugehen
Institute, Verbände und Ausbildungsrichtlinien
Literatur
Sachregister
Personenregister
Vorwort
Kunsttherapie ist ein viel versprechendes Wort. Es verweist auf ein Fach, das seinen Namen aus einer Amalgamierung zweier in ihren Interessen gegenläufiger Instrumente des sozialen Handelns bezieht. Wenn Kunst die imitierenden und irritierenden Kodes einer Gesellschaftsverfassung in eigenwilligen Material- und Verfahrensweisen entwirft, um eben diese Verfassung aufzubrechen und zu verändern, – dann will Therapie das Gegenteil: Menschen, die leidvoll aus ihren sozialen Kontexten herausgefallen sind, wieder dorthin zurückführen, wo sie sich geborgen fühlen.
Im Aufeinanderbezug, in der Kooperation der beiden Intentionen geschieht Bergendes und Irritierendes. Wenn verhaltensverunsicherte, mental geschädigte, psychisch erkrankte Menschen aus ihren Alltagskontexten gefallen sind, bieten sich Therapien an, um ehemalige, Halt gebende Bezüge wieder zu vermitteln. Wenn innere wie äußere Lebensbilder erstarrt, nicht mehr kommunizierbar sind, bieten sich künstlerische Therapieverfahren an, um kreativ und phantasievoll andere Bilder des Lebens zu erschließen. Wenn Kunst sich die therapeutischen Handlungsfelder erschließt, lassen sich die ästhetischen Einbahnstraßen des Lebens differenzieren, sodass individuelles Leben facettenreicher, in seinen gesellschaftlichen Bezügen wieder flexibel wird.
Der rehabilitativ, klinisch-psychosomatisch oder psychiatrisch erfasste Mensch ist von den unterschiedlichsten Einschränkungen seines Verhaltens betroffen. Er weiß um die Hilfestellung, die er in Hinblick auf ein verändertes Verhalten braucht. Er weiß jene Freiheit, Nicht-Stringenz, den Charakter der Nichteingebundenheit der Kunst in die gesellschaftlichen Zwänge zu schätzen: „Endlich keine Therapie“ – habe ich oft bei unseren kunsttherapeutischen Klinik-Projekten gehört, und ich habe erfahren, wie gut es tut, wenn Menschen, ansonsten leidend, Tätigkeitsräume erleben, die nicht in der gewohnten Alltagsart zwingend sind.
Von den Nöten und den Freiheiten dieser Menschen berichtet dieses Buch. Es sind hauptsächlich jene, die in ihrem Leben kaum zu Wort kamen. Es sind jene, die vor allem im Raum des nicht-gesellschaftsfähigen Ausdrucks zu Hause sind. Ihre Ausdrücke, ihre Bilder, die Bilder der behinderten und erkrankten Menschen – sie präsentieren eine Welt, die als abgespaltene, exterritorialisierte beschaut, bestaunt, zuweilen kulturausdrücklich gefeiert wird. In dem vorliegenden Buch wird diese Welt vorgestellt.
Das hier in der fünften Auflage vorgelegte Buch vermerkt seit seinem Erscheinen einen anfangs nicht für möglich gehaltenen Fortschritt des Faches auf dem Feld des Gesundheitswesens. Nach der teilweisen Zulassung der künstlerischen Therapieformen in der Akutklinik sind diese auch in der rehabilitativen Versorgung anzutreffen. Dieser Umstand ist wesentlich dem Einsatz vieler berufspolitisch tätigen KunsttherapeutInnen in der Bundesarbeitsgemeinschaft Künstlerischer Therapien (BAG KT) zu verdanken, deren Geschäftsführung ich an dieser Stelle für manche Hinweise bei der hier vorliegenden Überarbeitung danken möchte.
Ich danke Cornelia Schumacher und Christian Hamberger (beide BAG KT) für die kollegiale Hilfe bei der Erstellung der gesundheits- und berufsrechtlichen Aspekte für die fünfte Auflage.
TEIL I
KUNSTTHERAPIE – EINFÜHRUNG UND ÜBERBLICK
Wer einen Begriff vom Wesen und der Methode der Kunsttherapie gewinnen möchte, der hat sich zuerst darüber klar zu werden, wie innere Bilder auf die Psyche wirken und wie sie das Verhalten beeinflussen. Denn dass Bilder therapeutisch wirksam sein können, ist seit langem bekannt. Daher geht es den bildnerischen Therapien von Anfang an um einen Gestaltungsvorgang, der in seiner bildnerischen Dynamik den Zustand, die Befindlichkeit eines Menschen spiegelt und beeinflusst.
1 Zur Herkunft der künstlerischen Therapien
Bevor wir die verschiedenen Spezialisierungen dieser Therapieform nachzeichnen, wollen wir versuchen, die moderne Kunsttherapie in ihrem Wesen, ihren Ansätzen und Einsatzfeldern zu erfassen. Nach ihrer Herkunft lassen sich sechs Ansätze in der Kunsttherapie differenzieren:
1.ein kunstpsychologischer Ansatz in der Entstehenszeit dieser Disziplin;
2.ein kunstpädagogischer / -didaktischer Ansatz;
3.ein psychiatrischer, d. h. arbeits-, ergo- und beschäftigungstherapeutischer Ansatz;
4.ein heilpädagogischer Ansatz;
5.ein kreativ- und gestaltungstherapeutischer Ansatz und
6.ein tiefenpsychologischer Ansatz.
1.1 Der kunstpsychologische Ansatz
Die ästhetische Psychologie wird in Lehrbüchern wie dem von Kreitler und Kreitler (1980) auch unter dem Begriff der Kunstpsychologie subsumiert. Sie befasst sich seit ihren Anfängen mit den rezeptiven, reproduktiven und produktiven Äußerungsformen des künstlerischen Vorgangs, insoweit diese auf ein psychisches Korrelat der Empfindung oder des Gefühls, also auf die Organisierung von Bewusstseinsprozessen verweisen.
Seit der Zeit der Aufklärung wurde die menschliche Erfahrung als solche zunehmend verwissenschaftlicht. Kant unterschied einen sinnes-, verstandes- und einbildungskräftigen Aspekt an ihr. Nach welchen Regeln nehmen wir wahr und verstehen wir, nach welchen Regeln fällen wir Urteile, wenn wir Vorstellungen bildhafter, plastischer oder musikalischer Art in ihrer subjektiv-innersinnlichen Gefühlshaftigkeit einer jeweils objektiv-sinnlichen Wahrnehmung zuzuordnen, fragte er. Seit Kant lässt sich die Zusammenschau des sensualistischen Empfindens (Locke) und des intelligiblen Vorstellens (Leibniz) im ästhetisch-anschaulichen Wahrnehmungs- und Vorstellungsakt experimental-psychologisch verwenden. Die experimentell ausgerichtete psycho-physische Analyse des Erlebens fragt danach, wie ästhetisch wirkende physikalische Gegebenheiten und psychische Erfahrung korrelieren (Fechner 1871 / Ed. 1978).
Im Übergang von ästhetischer Theorie zur Psychologie steht ein Bewusstseinsverständnis, das den „ästhetischen Sinn“ (W. v. Humboldt) kunstpsychologisch und -didaktisch auszubilden auffordert: „Über die ästhetische Darstellung der Welt als das Hauptgeschäft der Erziehung“ lautet eines der frühen Werke Herbarts (1804); „Psyche und Ästhetik“ (Dannecker 2006) ist der Titel eines Buches unserer Tage, das jenem Gesichtpunkt folgt.
1.2 Der kunstpädagogische und kunstdidaktische Ansatz
Dieser Ansatz der zunächst erzieherischen, dann ansatzweise therapeutischen Arbeit mit musisch-bildnerischen Mitteln ist seit den Zeiten der Aufklärung zu verzeichnen: Pestalozzi zitiert die Kunstkräfte des Kindes, Schiller tritt für eine ästhetische Erziehung ein, mittels derer sich der heranwachsende Mensch spielerisch-ganzheitlich zu organisieren habe. Das Kind soll schließlich „kunstgemäß“ im Prozess der Erziehung erregt werden (Fröbel), um über die Darbietung ästhetischer Gegenstände eine Veredelung seiner Gemütsbestimmungen und Geschmacksurteile zu erfahren (Herbart 1841 / 1850–52). In der Klassik werden die Vorstellungen, was menschliche Natur ist (Goethe) oder sein soll (Schiller), von idealen Vorstellungen geprägt. Sie geben ein Bild des Kindes vor, das in die humanistischen und dann neuhumanistischen Erziehungskonzepte beispielsweise von Carus und Niethammer eingeht. In der Geschichte der Erziehung, die die inneren Anschauungen wie die Verhaltensweisen des Kindes formen will, setzt sich dieses (neu-)humanistische Bild, wie ein Kind sein soll, durch. Ganz in diesem Sinne wird die Kunst-, genauer die Mal- und Zeichenpädagogik in Dienst gestellt.
Читать дальше