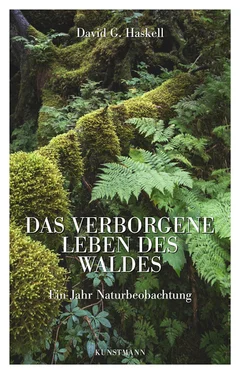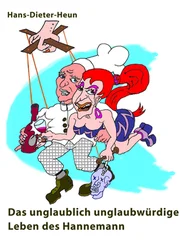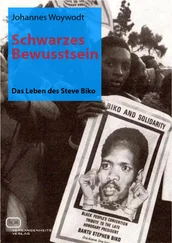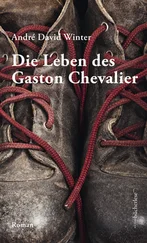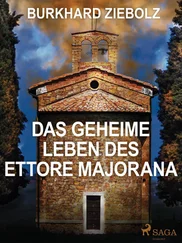Wenn das Wasser zwischen den Zellen vollständig gefroren ist, wird keine Wärme mehr freigesetzt. Doch das Wasser im Zellinneren ist noch immer flüssig. Es sickert nun durch die löchrige Zellmembran nach außen und lässt den Zucker im Zellinneren zurück – dessen große Moleküle die Membran nicht überwinden können. Mit sinkenden Temperaturen wird den Zellen also Wasser entzogen, so die Zuckerkonzentration im Zellinneren erhöht und der Gefrierpunkt weiter abgesenkt. Bei sehr tiefen Temperaturen wird aus der Zelle eine runzelige Sirupkugel: ein eisfreier Lebensquell, inmitten von Eisscherben.
Der Dolchfarn und die Moose im Mandala müssen eine weitere Herausforderung meistern. Ihre immergrünen Blätter und Stiele ernähren sie zwar an wärmeren Wintertagen, doch bei Kälte kann die Quelle ihres Grüns, das Chlorophyll, aus der Rolle fallen. Chlorophyll absorbiert Sonnenenergie und verwandelt sie in angeregt herumschwirrende Elektronen. Bei warmer Witterung wird der Elektronenenergiefluss in der Zelle schleunigst auf Nahrungsproduktion umgeschaltet. Doch bei kalter Witterung klemmt die Schaltung, sodass die Zelle von Elektronen in hoch angeregtem Zustand überschwemmt wird. Kann die Zelle die ziellos umherschwirrende Energie nicht eindämmen, vermüllt sie. Um sich vor dem Elektronenüberfall zu schützen, lagern immergrüne Pflanzen vor dem Winter chemische Stoffe in den Zellen ab, die die unerwünschte Elektronenenergie abfangen und neutralisieren. Wir kennen diese Stoffe als Vitamine, besonders Vitamin C und E. Schon die amerikanischen Ureinwohner wussten davon: Sie kauten zur Gesundheitsvorsorge im Winter immergrüne Pflanzen.
Wenn Eis in die Pflanzen des Mandalas eindringt, ziehen sich ihre Zellen behutsam zurück und erzwingen die mikroskopische Trennung zwischen Eis und Leben. Wenn die Pflanzen die Zellkontrak tion im Frühling wieder rückgängig machen, kehren Zweige, Knospen und Wurzeln ins Leben zurück. Und machen beinah weiter, als hätte es den Winter nie gegeben. Manche Pflanzen wählen allerdings einen anderen Weg. Das Leben des Leafcupkrauts endete nach kurzen achtzehn Monaten schon im letzten Herbst: Es ragt nun tot aus der Erde. Es hat vor dem Winter kapituliert und eine neue physische Form angenommen – wie Schnee, der sich in Dunst verwandelt. Und wie Dunst ist seine neue Form unsichtbar, auch wenn ich davon umgeben bin. Im Laubboden des Mandala vergraben, liegen Tausende von Leafcupsamen, die nur darauf warten, dass der Winter endlich vorbei ist. Sie überstehen die Wintermonate in einer harten Schale, die das Innere trocken hält und es ziemlich zuverlässig vor eiskalten Übergriffen schützt.
Der trostlose Eindruck, den das Mandala erweckt, ist nur ein oberflächlicher. Im Mandala leben Hunderttausende von eingekapselten Pflanzenzellen, die ihr Rückzug stark gemacht hat. Ihr ruhiges Grau täuscht wie bei Schießpulver über die latente Energie hinweg, die in ihnen steckt. Meisen und andere Vögel stellen ihre Lebenskraft im Januar zwar aufgeregt zur Schau, doch ist ihre Energie beinah lächerlich im Vergleich zu der, die sich in den stillen Pflanzen verbirgt. Wenn es Frühling wird und im Mandala schießt und sprießt, trägt die entfesselte Pflanzenenergie den gesamten Wald, auch die Vögel, durch ein weiteres Jahr.

DIE SPITZEN EINES SCHNEEBALLSTEAUCHS wurden weggemeißelt, an seinen Zweigen sitzen nur noch schräge Stummel. Doch das Tier, das die zarten Enden abgeknipst hat, hat im Mandala eine Spur hinterlassen: drei Abdrücke im Laubboden, die von Ost nach West zeigen, mit jeweils zwei mandelförmigen Vertiefungen, etwa fünf Zentimeter tief. Alles deutet auf einen Zehenspitzengänger hin, es ist ein Trittsiegel aus dem Paarhuferclan. Wie fast alle terrestrischen Gemein schaften der Welt wurde das Mandala von einem Säugetier mit gespal tenem Huf heimgesucht, in diesem Fall einem Weißwedelhirsch.
Der Hirsch, der das Mandala letzte Nacht durchquert hat, hat eine kluge Wahl getroffen. Der Ahornblättrige Schneeballstrauch hat derzeit in seinen Zweigspitzen Nahrung gelagert, als Vorbereitung auf den Frühling. Die jungen Triebe sind noch nicht hart und holzig. Der Strauch wurde also seines zarten Grüns beraubt, das verdaut und in Hirschmuskeln reinvestiert wurde – oder, falls der Knibbler eine Hirschkuh war, in das Kalb im Mutterleib.
Der Hirsch hatte Hilfe. Um die Nahrungsvorräte, die in den harten Zellen von Zweigen und Blättern eingeschlossen sind, zu plündern, müssen nämlich Groß und Klein zusammenarbeiten. Große, vielzellige Tiere können zwar Holziges knabbern und kauen, aber keine Zellulose verdauen, die Moleküle also, aus denen die meisten Pflanzen bestehen. Doch Mikroben, winzige Einzeller wie Bakterien und Protisten, sind zwar mickrig gebaut, aber dafür chemisch stark. Bei Zellulose fackeln sie nicht lange. Daraus ist eine Diebesbande entstanden: Die pflanzenzermahlenden Tiere, die durch die Gegend streunen, machen mit den Mikroben, die pulverisierte Zellulose verdauen, gemeinsame Sache. Verschiedene Tiergruppen haben dabei, völlig unabhängig voneinander, denselben Plan ausgeheckt: Die Termiten arbeiten mit den Protisten zusammen, die ihren Darm bewohnen; Kaninchen und Verwandte beherbergen in einer großen Kammer am Ende ihres Verdauungstrakts Mikroben, und der Stinkvogel, ein seltsamer blätterfressender Vogel in Südamerika, besitzt sogar einen Gärsack im Hals. Und Wiederkäuer wie Hirsche können in ihrem Spezialmagen, dem Pansen, gar auf eine ganze Wundertüte voller Helfer zählen.
Die Mikrobenpartnerschaft sorgt dafür, dass große Tiere die im Pflanzengewebe verborgenen Energielager aufschließen können. Tiere, wie auch der Mensch, die keinen Vertrag mit den Mikroben haben, sind dagegen in ihrer Nahrungsauswahl beschränkt: auf weiche Früchte, einige leicht verdauliche Samen oder Milch und Fleisch ihrer vielseitigeren tierischen Verwandten.
Die Triebe im Mandala wurden mit den unteren Zähnen und der harten oberen Gaumenplatte abgeknipst, die die oberen Vorderzähne ersetzt. Dann wurden die holzigen Happen an die hinteren Zähne weitergeschickt, zermahlen und heruntergeschluckt. Als sie schließlich im Pansen landeten, betraten sie ein neues Ökosystem, ein gewaltiges Mikroben-Schleuderfass. Der Pansen ist ein Beutel, von dem die übrigen Verdauungsorgane des Hirschs abzweigen. Sämtliche Nahrung außer der Muttermilch geht zunächst durch den Pansen, ehe sie dann den übrigen Magen und den Darm passiert. Der Pansen ist von Muskeln umgeben, die den Panseninhalt schleudern. Hautlappen im Pansen, die Zotten, arbeiten wie die Trommelrippen einer Waschmaschine: Sie wenden die Nahrung beim Schleudern hin und her.
Die meisten Mikroben im Pansen ertragen keinen Sauerstoff. Sie stammen von altertümlichen Lebewesen ab, die sich einst unter völlig anderen atmosphärischen Bedingungen entwickelten. Erst als vor ungefähr zweieinhalb Milliarden Jahren die Fotosynthese erfunden wurde, kam der Sauerstoff in die Luft unserer Erde; doch weil Sauerstoff eine gefährliche reaktive Chemikalie ist, hat diese Giftverschmutzung unseres Planeten vielen Lebewesen den Garaus gemacht – und viele andere gezwungen, sich zu verkriechen. Bis heute leben die Sauerstoffhasser in Teichgründen, Sümpfen oder tief unter der Erde, wo sie ein sauerstoffloses Dasein fristen. Andere dagegen haben sich dem neuen Umweltverschmutzer angepasst und konnten den giftigen Sauerstoff, durch ein elegantes Ausweichmanöver, zum eigenen Vorteil nutzen. So entstand die Sauerstoffatmung, ein Energie freisetzender biochemischer Trick, den auch wir übernommen haben. Unser Leben hängt also von einem urzeitlichen Luftverschmutzer ab.
Mit der Entwicklung des tierischen Darms bot sich den sauerstoffhassenden Flüchtlingen dann ein neues Versteck. Der Darm ist nicht nur relativ sauerstofffrei, sondern der Traum jeder Mikrobe: fein gemahlene Nahrung am laufenden Band. Es gab allerdings ein Problem. In Tiermägen befinden sich normalerweise saure Verdauungssäfte, die alles Leben zerstören. Die meisten Tiere konnten somit keine pflanzenverdauenden Mikroben beherbergen. Nur die Wiederkäuer veränderten, als perfekter Wirt, ihren Magen und wurden folgerichtig mit einer Vier-Sterne-Bewertung für evolutionären Erfolg belohnt. Kernstück ihrer Gastlichkeit sind Lage und Freundlichkeit des Pansens, der vor den übrigen Verdauungsorganen liegt und sich stets neutral verhält, weder sauer noch basisch. Die Mikroben blühen in diesem Schleuder-Spa geradezu auf. Der basische Speichel der Tiere neutralisiert zudem alle sauren Verdauungsprodukte. Und etwaiger Sauerstoff wird von einer kleinen Truppe von Bakterien als Zimmermädchen aufgesaugt.
Читать дальше