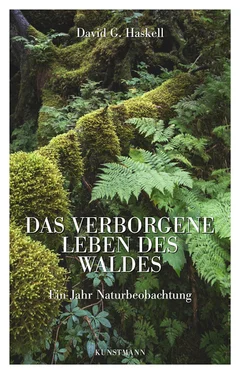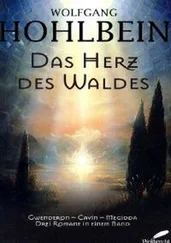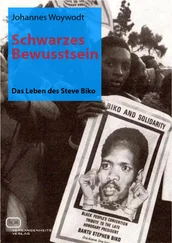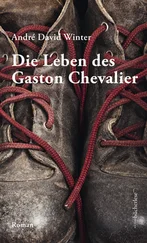Im Sommer kann das Mandala wesentlich mehr Vögel ernähren, aber weil die Hülle und Fülle von Standvögeln wie den Carolinameisen durch die kärgliche Winternahrung ausgedünnt ist, übersteigt das sommerliche Futterangebot ihren Appetit bei Weitem. Die saisonale Futterflut machen sich die Zugvögel zunutze, wenn sie lange Flüge von Mittel- und Südamerika auf sich nehmen, um am Überfluss der nordamerikanischen Wälder teilzuhaben. Die Winterkälte ist somit für den jährlichen Vogelzug von Millionen von Tangaren, Waldsängern und Vireos verantwortlich.
Der nächtliche Tod fördert außerdem die Feinanpassung der Carolinameisen an ihre Umwelt: Kleine Carolinameisen sterben eher als rundlichere Familienangehörige, wodurch sich das Bergmann’sche Breitengradmuster verstärkt. Extreme Kälte sortiert ferner alle Vögel einer Population aus, deren Zittern, Federflaum oder Energiereserven mangelhaft sind. Am nächsten Morgen wird die Meisenpopulation im Wald noch besser an die winterlichen Bedingungen angepasst sein. Das ist das Paradox der natürlichen Selektion: Das zunehmend perfektere Leben erwächst aus dem Tod.
Meine eigene Unzulänglichkeit bei Kälte hat ihren Grund ebenfalls in der natürlichen Selektion. Ich bin im Schneemandala fehl am Platz, weil meine Vorfahren, was Kälte und Abhärtung betraf, einen großen Bogen um die Selektion gemacht haben. Der Mensch stammt bekanntlich vom Affen ab – der Aberdutzende Jahrmillionen im tropischen Afrika lebte. Und da dort die größere Herausforderung darin bestand, den Körper kühl zu halten, besitzt unser Körper wenig, was ihn vor Kälte schützen könnte. Als meine Vorfahren Afrika verließen und nach Nordeuropa einwanderten, hatten sie Feuer und Kleidung dabei: Sie versetzten die Tropen einfach in die gemäßigten Zonen und Polargebiete. Durch ihr kluges Vorgehen konnten sie viel Leid und Tod verhindern – zweifellos ein wünschenswerter Erfolg. Doch der Komfort schlug der natürlichen Selektion ein Schnippchen. Feuer und Kleidung haben uns auf ewig dazu verdammt, in der Welt des Winters fehl am Platz zu sein.
Es wird dunkel, ich kehre zum Erbe meiner Vorfahren, dem warmen Ofen zurück und überlasse das Mandala den Vögeln, den Meistern der Kälte. Ihre Meisterschaft haben sie auf die harte Tour gelernt: im Kampf, geführt von Tausenden von Generationen. Ich wollte die Kälte genauso erleben wie die Tiere im Mandala, muss aber einsehen, dass das nicht geht. Mein Körper hat sich evolutionär anders entwickelt als der der Meisen; dasselbe zu erleben ist uns darum verwehrt. Dennoch: Seitdem ich mich in meiner Nacktheit dem eisigen Wind ausgesetzt habe, ist meine Bewunderung für jene anderen Wesen noch gestiegen. Ich kann nur staunen.
30. JANUAR
Winterpflanzen

DAS ENDLOSE DUMPFE BRÜLLEN kommt vom Wind, der an den Bäumen zerrt, die oberhalb des Mandalas auf dem hohen Sandsteinfels stehen. Anders als der Nordwind Anfang der Woche weht der stürmische Wind jetzt von Süden, doch weil das Mandala im Windschatten des Felsens liegt, sind hier nur leichte Wirbel und Windböen zu spüren. Der Südwind hat angenehmere Temperaturen gebracht. Es ist nur knapp unter null, warm genug, um in Winterkleidung eine Stunde oder länger bequem dazusitzen. Die erbarmungslose, physisch schmerzende Kälte ist vorbei: In der milden Luft durchströmt meinen Körper ein leises Wohlbehagen.
Ein vorbeikommender Vogelschwarm ist – erlöst vom arktischen Todesgriff – offenbar in ausgelassener Stimmung. Fünf Vogelarten sind gemeinsam unterwegs: fünf Indianermeisen, ein Carolinameisenpaar, ein Carolinazaunkönig, ein Indianergoldhähnchen und ein Carolinaspecht. Der Schwarm scheint wie durch ein unsichtbares Gummiband zusammengehalten: Wenn ein Vogel zurückbleibt oder weiter streunert, als es der Zehnmeterradius des Schwarms erlaubt, wird er unweigerlich ins Zentrum zurückgezogen. Wie ein flirrender Kugelblitz schwirrt der Schwarm durch den erstarrten Winterwald.
Am singfreudigsten sind die Indianermeisen: Sie geben unentwegt Töne von sich. In unregelmäßigem Rhythmus stoßen sie ein hohes siet aus, das ihre anderen Rufe, ein heiseres Pfeifen und Fiepen, dann umspielen. Einige Vögel zwitschern pi-ta pi-ta , ein Ruf, der in ihrem Repertoire am eisigen Wochenanfang noch fehlte. Die helle zweitönige Melodie ist ihr Brutgesang. Trotz Schnee denken die Vögel schon an den Frühling. Bis sie Eier legen, wird es noch einige Monate dauern, doch ihr Liebeswerben mit schwierigen sozialen Verhandlungen hat schon begonnen.
Die überschwängliche Lebensfreude der Vögel steht in starkem Kontrast zum Pflanzenleben im Mandala. Die grauen Äste und kahlen Zweige bieten ein trostloses Bild. Aus dem Schnee stakt der Tod: niedergestürzte, teils verfaulte Ahornäste, zerfaserte Stümpfe von Leaf cupstängeln und um die Stängel angetauter Schnee, durch den verrottendes Laub hindurchscheint. Scheinbar hat der Winter die Pflanzen vollständig besiegt.
Doch das Leben geht weiter.
Die kahlen Büsche und Bäume sind nicht bloß Gerippe, auch wenn es so aussieht. Zweige und Stämme sind von lebendem Gewebe umhüllt. Während die Vögel dem harten Winter trotzen, indem sie selbst der klirrendsten Kälte noch Nahrung abringen, harren die Pflanzen aus, ohne sich ihren eigenen Sommer zu schaffen. Dass Vögel in der Kälte überleben, mag erstaunen, doch dass Pflanzen nach der vollständigen Kapitulation wiederauferstehen, ist so weit von jeder menschlichen Vorstellung entfernt, dass es beinah unanständig scheint. Nach dem Tod, noch dazu dem Erfrierungstod, dürfte es keine Wiederkehr mehr geben.
Doch sie kehren wieder. Pflanzen überleben ähnlich wie Schwertschlucker: durch sorgfältige Vorbereitung und höchste Vorsicht vor scharfen Kanten. Pflanzen kommen mit bloßer Kälte normalerweise gut zurecht. Im Gegensatz zu den chemischen Reaktionen, die den Menschen am Leben erhalten, funktioniert die pflanzliche Biochemie bei verschiedenen Temperaturen und versagt auch nicht, wenn es kälter ist. Doch wenn aus Kälte Frost wird, fangen die Probleme an: Die wachsenden Eiskristalle zerstechen, zerreißen und zerstören die zarte innere Zellarchitektur. Im Winter müssen Pflanzen Zehntausende von Schwertern schlucken und ständig aufpassen, dass keins ihrer verletzlichen Seele zu nahe kommt.
Die Pflanzen beginnen schon Wochen vor dem ersten Frost mit den notwendigen Vorbereitungen. Sie befördern DNA und andere empfindliche Strukturen ins Zellzentrum und umhüllen sie mit einem Polster. Die Zellen werden fettiger, und die chemischen Fettverbindungen verändern sich so, dass sie bei Kälte flüssig bleiben. Die Zellmembranen werden löchrig und biegsam. Die verwandelten Zellen sind nun gut gepolstert und geschmeidig. Sie erdulden selbst grausame Kälte, ohne Schaden zu nehmen.
Die Wintervorbereitungen der Pflanzen nehmen Tage oder Wochen in Anspruch. Darum kann ein überraschender Frosteinbruch Äste sterben lassen, die sonst, bei geeigneter Akklimatisierung, kälteste Winternächte überstehen. Heimische Pflanzenarten werden selten vom Frost überrumpelt; die natürliche Selektion hat sie den Jahreszeitenrhythmus ihrer Heimat gelehrt. Doch exotische Pflanzen kennen sich vor Ort nicht aus und werden vom Winter oft zurechtgestutzt.
Die Zellen verändern nicht nur ihre physische Struktur, sondern saugen sich auch voll Zucker und senken so den Gefrierpunkt – wie das Salz auf unseren vereisten Straßen. Doch nur das Zellinnere wird gezuckert, das Wasser um die Zellen bleibt ungesüßt. Dank dieser Asymmetrie können sich die Pflanzen das absehbare Geschenk der Naturgesetze zunutze machen: Bei Eisbildung wird Wärme freigesetzt. Wenn Zellen von gefrierendem Wasser umgeben sind, steigt ihre Temperatur um mehrere Grad an. Beim ersten Frost ist das zuckrige Zellinnere daher durch das ungezuckerte Wasser geschützt, das die Zellen umhüllt. Auch Landwirte machen sich diese Wärmeerzeugung übrigens zunutze, wenn sie ihre Getreidepflänzchen in Frostnächten benebeln und so eine weitere Schicht wärmespendendes Wasser hinzugeben.
Читать дальше