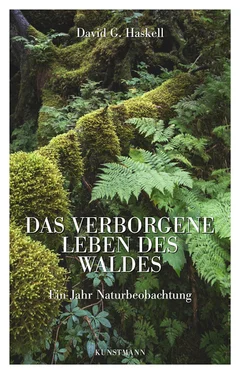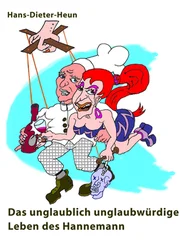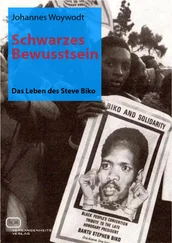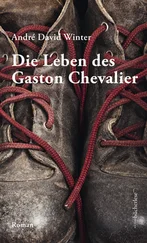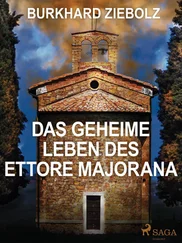Wie entsteht so viel Schönheit?
Im Jahr 1611 opferte Johannes Kepler ein wenig seiner kostbaren Zeit, die er gewöhnlich der Erhellung der Planetenbewegungen widmete, um über Schneeflocken zu sinnieren. Ihn faszinierte besonders die Regelmäßigkeit der sechseckigen Schneeflocken: »Da jedes Mal, sooft es zu schneien beginnt, jene ersten Elemente des Schnees die Form sechsstrahliger Sternchen aufweisen, so muß eine bestimmte Ursache vorhanden sein.« Kepler suchte in den Gesetzen der Mathematik und in naturgeschichtlichen Formen nach einer Antwort auf seine Frage. Er stellte fest, dass Bienenwaben und Granatapfelkerne ebenfalls eine sechseckige Form aufweisen. Doch da Wasserdampf, anders als Granatapfelkerne, weder in Schalen gepresst noch von Insekten geformt wird, kam er zu dem Schluss, dass uns diese Naturbeispiele nichts über die Ursache der Schneeflockenarchitektur verraten können. Und weil viele Blüten und Mineralien ebenfalls der Sechseckregel widersprechen, lief seine Suche auch dort ins Leere. Selbst die Geometrie musste Kepler von der Liste der Möglichkeiten streichen, denn Drei-, Vier- und Fünfecke bilden genauso hübsche geometrische Muster.
Kepler schrieb schließlich, dass sich in den Schneeflocken die Kraft der Natur und Gottes offenbare, die »gestaltende Seele«, die allem Sein innewohne. Doch die mittelalterliche Lösung befriedigte ihn letztendlich nicht. Er suchte eine wissenschaftliche Erklärung, keinen Fingerzeig Gottes. Sein Aufsatz endet mit Worten der Enttäuschung; es war ihm nicht gelungen, einen Blick in den eisigen Palast des Wissens zu erhaschen.
Seine Enttäuschung wäre geringer ausgefallen, hätte er die Lehre von den Atomen ernst genommen. Doch die Atomlehre, die auf die klassische griechische Philosophie zurückging, war bei Kepler und den meisten Wissenschaftlern des frühen 17. Jahrhunderts in Ungnade gefallen. Allerdings näherte sich das zweitausendjährige Exil der Atome seinem Ende. Zum Ausgang des 17. Jahrhunderts waren Atome wieder en vogue: Triumphierend tänzelten Kugeln und Stäbe über Bücher und Tafeln. Heute setzen wir die Eiskristalle Röntgenstrahlen aus, um ihre Atome aufzuspüren, und durch die Form der austretenden Strahlung offenbart sich uns eine Welt, die eine Billiarde Mal kleiner ist als der übliche Maßstab menschlichen Lebens. Wir entdecken die gezackten Linien der Sauerstoffatome, die jeweils an zwei ruhe lose Wasserstoffatome, herumflitzende Elektronen, gekettet sind. Wir umkreisen die Wassermoleküle, prüfen ihre Regelmäßigkeit von allen Seiten und erkennen erstaunt Atome, die wie Keplers Granatapfelkerne angeordnet sind. Wir haben damit die Ursache der Schneeflockensymmetrie gefunden: Die sich anlagernden sechseckigen Wassermolekülringe wiederholen ihren Sechseckrhythmus unermüdlich und vergrößern die Anordnung der Sauerstoffatome dadurch so stark, dass sie für das menschliche Auge sichtbar wird.
Wenn Eiskristalle wachsen, entwickelt sich die grundlegende Sechseckform der Schneeflocken weiter. Für ihre endgültige Form spielen Temperatur und Luftfeuchtigkeit eine entscheidende Rolle. So bilden sich in sehr kalter, trockener Luft sechseckige Prismen. Der Südpol ist mit solch einfachen Formen übersät. Mit steigender Temperatur wird das streng sechseckige Wachstum der Eiskristalle dagegen instabiler. Die Ursache der Instabilität ist noch nicht endgültig erforscht, aber offenbar gefriert Wasserdampf an manchen Eiskristallkanten schneller als an anderen, und schon geringe Veränderungen in den Luftbedingungen können die Anlagerungsgeschwindigkeit wesentlich beeinflussen. In sehr feuchter Luft wachsen den sechs Schneeflockenecken daher »Arme«, die sich wieder in neue sechseckige Plättchen verwandeln oder, bei ausreichend warmer Temperatur, weitere Anhängsel hervorbringen und die Arme der wachsenden Sterne vervielfachen. Bei anderen Temperatur- und Feuchtigkeitskombinationen bilden sich dagegen Hohlprismen, Nadeln oder zerfurchte Plättchen. Wenn es schneit, schleudert der Wind die Schneeflocken durch die Luft und damit durch unzählige winzig unterschiedliche Temperatur- und Feuchtigkeitsbereiche. Nicht zwei Schneeflocken erleben dasselbe, und ihre Geschichte spiegelt sich in den einzigartigen Eiskristallen wieder, aus denen sie bestehen. Der Zufall der Geschichte spielt mit den Gesetzen der Eiskristallbildung und erzeugt eine Spannung aus Ordnung und Abweichung, die unserem Schönheitsempfinden ungemein schmeichelt.
Könnte uns Kepler heute besuchen, würde ihm unsere Lösung des Rätsels von der schönen Schneeflocke vermutlich gefallen. Denn er war mit seiner Beobachtung der sorgfältig angeordneten Granatapfelkerne und Bienenwaben auf der richtigen Spur. Die Ursache für die sechseckigen Schneeflocken liegt letztendlich in der Geometrie dicht gepackter Kugeln. Aber weil Kepler nichts über Atome und ihre Bedeutung für die materielle Welt wusste, konnte er sich keine winzigen Sauerstoffatome vorstellen, aus denen Eisgeometrien erwachsen. Über einen Umweg trug Kepler allerdings doch zur Lösung des Problems bei. Seine Schneeflocken-Grübelei bewog andere Wissenschaftler dazu, der Geometrie von Kugelpackungen nachzugehen, und ihre Studien wiederum leisteten einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der modernen Atomlehre. Keplers Aufsatz gilt heute als eine der Grundlagen des modernen Atomismus – eine Weltsicht, die Kepler allerdings ausdrücklich ablehnte, als er einem Kollegen gegenüber äußerte, er könne sich nicht ad atomos et vacua, »mit Atomen und leeren Räumen« gemeinmachen. Doch Keplers Erkenntnisse halfen anderen, das zu sehen, was ihm zu sehen verwehrt blieb.
Ich wende mich wieder den Glassternen auf meinem Finger zu. Dank Kepler und anderen, die ihm nachfolgten, sehe ich nun nicht nur Schneeflocken, sondern Atomskulpturen – ein Atomium. Nirgendwo sonst im Mandala ist die Beziehung zwischen der klitzekleinen Welt der Atome und dem groben Reich meiner Sinne so einfach. Alles andere wie Gestein, Borke, meine Haut oder meine Kleidung besteht aus einem so komplexen Molekülgewirr, dass mir der äußere Anblick nichts über die minutiöse innere Struktur verrät. Die sechseckigen Eiskristalle geben mir einen unmittelbaren Einblick in das, was normalerweise unsichtbar ist: die Geometrie der Atome. Ich schüttle die Flocken vom Finger, und sie fallen zurück in das große Meer aus geballtem Weiß.
21. JANUAR
Das Experiment

EISIGER WIND PEITSCHT ÜBER das Mandala, dringt durch meinen Schal, am Kiefer spüre ich einen stechenden Schmerz. Es ist windig und zwanzig Grad unter null. Solche Temperaturen sind in den süd lichen Wäldern der USA ungewöhnlich. Im Winter wechseln sich hier meistens Tauwetter und leichter Frost ab, nur wenige Tage im Jahr sinkt die Temperatur tiefer. Die derzeitige Kälte bringt das Leben im Mandala an seine physischen Grenzen.
Ich möchte die Kälte spüren wie die Tiere im Wald, ohne schützende Kleidung. Aus einer Laune heraus werfe ich Handschuhe und Mütze auf den gefrorenen Boden, lasse den Schal folgen. Dann ziehe ich blitzschnell den kälteisolierenden Overall sowie Hemd, T-Shirt und Hose aus.
Die ersten zwei Sekunden ist das Experiment überraschend erfrischend; ohne die stickige Kleidung ist es angenehm kühl. Doch dann fegt der Wind alle Illusionen hinweg, und mein Kopf ist schmerzbenebelt. Die Wärme strömt aus meinem Körper, meine Haut brennt.
Ein Carolinameisenchor liefert die Begleitmusik zu meinem grotesken Striptease. Die Vögel tanzen wie Funken durch die Bäume, huschen durch die Zweige. Sie verharren nirgends länger als eine Sekunde, dann zischen sie davon. Dass die Meisen so lebhaft sind, ich aber in der Kälte physisch versage, scheint den Naturgesetzen zu widersprechen. Kleine Tiere sollten mit der Kälte schlechter zurechtkommen als ihre großen Verwandten! Das Volumen von Objekten, auch von tierischen Körpern, nimmt mit der Objektlänge kubisch zu. Und da sich die Wärmemenge, die ein Tier erzeugen kann, proportional zum Körpervolumen verhält, erhöht sich die erzeugte Wärmemenge mit der Körpergröße kubisch. Die Oberfläche, über die Wärme verloren geht, wächst dagegen mit zunehmender Länge nur im Quadrat. Kleine Tiere kühlen schneller aus, weil ihr Körper im Verhältnis viel mehr Oberfläche als Volumen besitzt.
Читать дальше