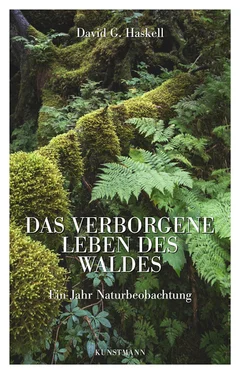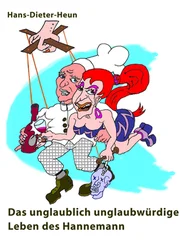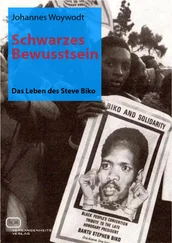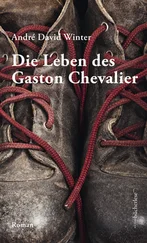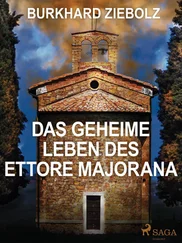Das Verhältnis zwischen Größe und Wärmeverlust eines Tiers hat bestimmte geografische Gesetzmäßigkeiten in puncto Körpergröße hervorgebracht. Wenn eine Tierart weite Landstriche besiedelt, sind ihre nördlichen Vertreter gewöhnlich größer als ihre südlichen. Das nennt man – nach dem Anatom, der das Phänomen im 19. Jahrhundert zuerst beschrieb – die Bergmann’sche Regel. So sind die Carolina meisen in Tennessee, die im äußersten Norden ihres Verbreitungsgebiets leben, zehn bis zwanzig Prozent größer als die Exemplare in Florida, im südlichsten Verbreitungsgebiet. Bei den Vögeln in Tennessee hat sich das Verhältnis zwischen Körperoberfläche und Körpervolumen verschoben, um die Anpassung an den kalten Winter zu verbessern. Noch weiter im Norden nimmt dann eine enge Verwandte, die Schwarzkopfmeise, den Platz der Carolinameise ein: Sie ist noch einmal zehn Prozent größer.
Die Bergmann’sche Regel scheint mir ziemlich fern, als ich nackt im Wald stehe. Es geht ein scharfer Wind, und das Brennen auf der Haut verstärkt sich rasch. Dann spüre ich plötzlich einen tiefer gehenden Schmerz. Irgendetwas außerhalb meines Bewusstseins sitzt in der Falle und schlägt Alarm. Nach nur einer Minute in winterlicher Kälte hat mein Körper vollständig versagt. Dabei wiege ich zehntausend Mal mehr als eine Meise. Eigentlich müssten diese Vögel in Sekundenschnelle tot sein.
Ihr Überleben verdanken die Meisen zum Teil ihrem kälteisolierenden Gefieder, das ihnen gegenüber meiner nackten Haut einen klaren Vorteil verschafft. Ihr glattes, oberes Federkleid wird durch versteckte Daunenfedern aufgebauscht. Daunenfedern bestehen aus Tausenden dünner Proteinstränge. Die winzigen Härchen bilden einen federleichten Flaum, der Wärme zehn Mal besser speichert als ein Styroporbecher. Im Winter verdoppeln die Vögel die Zahl ihrer Federn und verbessern so die Isolierfähigkeit ihres Gefieders. An kalten Tagen spannen Vögel zudem die Muskeln unter dem Gefieder an, sie plustern sich auf, sodass ihre Isolierung doppelt so dick wird. Doch auch ihr eindrucksvoller Kälteschutz kann das Unvermeidliche nur ein wenig hinausschieben. Die Haut der Meisen brennt nicht wie meine in der Kälte, gibt aber trotzdem Wärme ab. Ein oder zwei Zentimeter Daunengepluster zögern den Kältetod höchstens ein paar Stunden hinaus.
Ich lehne mich in den Wind. Das Gefühl der Bedrohung wächst. Mein Körper zuckt und zittert unkontrollierbar.
Die chemischen Reaktionen, mit denen ich normalerweise Wärme erzeuge, erweisen sich als vollkommen unzureichend, und die anfallsartigen Muskelzuckungen sind der letzte Versuch, das Absinken der Kerntemperatur noch aufzuhalten. Meine Muskeln feuern scheinbar wahllos, ziehen sich gegenseitig zusammen, ich schlottere am ganzen Körper. Im Muskelinneren werden Nahrungsmoleküle und Sauerstoff verbrannt, als würde ich laufen oder schwer heben, doch die Verbrennung erzeugt jetzt einen Wärmerausch: Durch das zwanghafte Schlottern in Beinen, Brust und Armen wird das Blut erwärmt und die Wärme zum Gehirn und Herzen transportiert.
Zittern ist auch die wichtigste Strategie, mit der sich Meisen gegen Kälte verteidigen. Im Winter nutzen die Vögel ihre Muskeln als Wärmepumpen. Wenn sie in der Kälte nicht aktiv sind, erzittern ihre Muskeln. Ihre wichtigste Wärmequelle sind dabei Flugmuskelpakete in der Brust. Die Flugmuskeln machen ungefähr ein Viertel des Meisengewichts aus; wenn sie zittern, wird also warmes Blut in Hülle und Fülle erzeugt. Menschen besitzen keine vergleichbar großen Muskeln, unser Zittern und Bibbern fällt daher eher bescheiden aus.
Als ich so zitternd dastehe, steigt Angst in mir auf. Ich gerate in Panik und kleide mich so schnell wie möglich an. Meine Hände sind klamm, nur mit Mühe halten meine Finger die Kleidung, ich friemele an Reißverschlüssen und Knöpfen herum. Mein Kopf schmerzt, als hätte ich unversehens Bluthochdruck. Ich verspüre nur einen Wunsch: mich zu bewegen. Ich renne, springe und rudere mit den Armen. Mein Gehirn signalisiert mir: Sorg für Wärme, aber schnell.
Das Experiment war nach einer Minute beendet; das entspricht etwa einem Zehntausendstel der Zeit, die diese arktische Woche dauert. Dennoch, mein Körper ist aus dem Takt. Mein Kopf hämmert, meine Lungen lechzen nach Luft, meine Gliedmaßen sind förmlich gelähmt. Wenige Minuten später wäre mein Körper unterkühlt gewesen, jede noch so flüchtige Muskelkoordination vergeblich; Benommenheit und Halluzinationen hätten von mir Besitz ergriffen. Normalerweise hält der menschliche Körper eine Temperatur von ungefähr siebenunddreißig Grad Celsius aufrecht. Wenn die Körperkerntemperatur nur um ein wenig, auf vierunddreißig Grad sinkt, kommt es zu geistiger Verwirrung. Bei dreißig Grad schalten sich die ersten Organe ab. Damit die Temperatur so weit abfällt, muss man bei eisigem Wind wie heute nur eine Stunde nackt der Kälte ausgesetzt sein. Meiner klugen kulturellen Kälteanpassung entkleidet, entpuppe ich mich als tropischer Affe, der im Winterwald vollkommen fehl am Platz ist. Die mühelose Überlegenheit der Meisen ist geradezu demütigend.
Nachdem ich fünf Minuten lang Arme und Beine wie der Teufel bewegt habe, verkrieche ich mich noch tiefer in meine Kleidung: Ich fröstele noch, bin aber nicht mehr in Panik. Meine Muskeln sind ermüdet, ich fühle mich erschöpft wie nach einem Sprint. Erst jetzt spüre ich, welche Strapaze die Wärmeerzeugung für meinen Körper bedeutet. Wenn ein Tier länger als ein paar Minuten zittert, können seine Energiereserven schnell verbraucht sein. Darum ist Hunger bei Forschern der Spezies Mensch und wilden Tieren häufig ein Vorbote des Todes. Solange wir genügend Nahrungsvorräte besitzen, können wir uns zitternd und bibbernd am Leben erhalten, doch mit leerem Magen und verbrauchten Fettreserven gibt es keine Rettung mehr.
Ich kann meine Reserven wieder auffüllen, wenn ich in meiner warmen Küche bin, wo ich dem Winter dank Nahrungskonservierungs- und Transporttechnologien erfolgreich trotze. Doch Meisen verfügen weder über Trockengetreide noch Nutztierhaltung oder importiertes Gemüse. Wenn sie im Winter überleben wollen, müssen sie genügend Futter finden, um ihren Minibrennofen in Gang zu halten.
Der Energieverbrauch von Meisen wurde im Labor und bei frei lebenden Vögeln gemessen. An einem Wintertag wie diesem brauchen Vögel fünfzehntausend Kilokalorien, um sich am Leben zu erhalten. Die Hälfte der benötigten Energie fällt für das Zittern an. Die abstrakten Zahlen werden ein wenig konkreter, wenn wir sie in die Währung »Vogelnahrung« umrechnen. Eine Spinne, so groß wie ein Komma auf dieser Seite, enthält gerade einmal 0,25 Kilokalorien. Eine Spinne in Großbuchstabengröße entspricht fünfundzwanzig Kilokalorien und ein wortgroßer Käfer 60 Kilokalorien. Ein öliger Sonnenblumenkern hat fast zweihundertfünfzig Kalorien, doch die Vögel hier müssen ohne körnergefüllte Futterspender auskommen. Um ihren Energiebedarf zu decken, müssen die Meisen täglich Hunderte von Futterbröckchen finden. Aber in der Mandalaspeisekammer herrscht Ödnis und Leere. Ich sehe im frostgeplagten Wald keine Käfer, Spinnen oder anderes Essbares.
Meisen können dem scheinbar wertlosen Wald noch Nährstoffe abgewinnen, vor allem, weil sie hervorragend sehen. Auf der Netzhaut ihrer Augen sind die Rezeptoren doppelt so dicht gepackt wie meine. Vögel sehen schärfer und detaillierter als ich. Wo ich die glatte Oberfläche eines Zweiges erblicke, sehen sie Risse und raue Zerklüftungen, in denen sich möglicherweise Nahrung verbirgt. Viele Insekten überwintern in winzigen Rindenritzen, aber Meisen stöbern die Insektenverstecke mit scharfem Blick auf. Den Reichtum ihrer visuellen Welt zu erleben ist uns verwehrt, doch wenn wir durch eine Lupe schauen, erhalten wir eine kleine Vorstellung davon: Details, die sonst unsichtbar sind, geraten plötzlich in den Blick. Ihre Wintertage verbringen Meisen großteils damit, ihren messerscharfen Blick über Zweige, Stämme und Laubboden schweifen zu lassen und Futterverstecke aufzuspüren.
Читать дальше