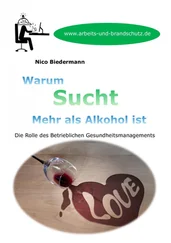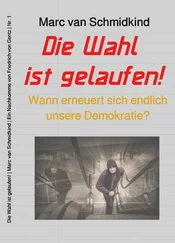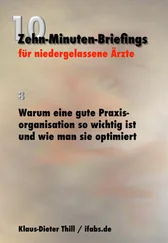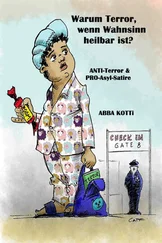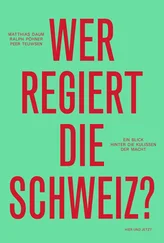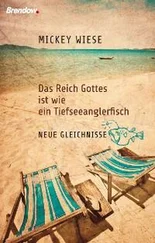Markus Somm - Warum die Schweiz reich geworden ist
Здесь есть возможность читать онлайн «Markus Somm - Warum die Schweiz reich geworden ist» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Warum die Schweiz reich geworden ist
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Warum die Schweiz reich geworden ist: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Warum die Schweiz reich geworden ist»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Warum die Schweiz reich geworden ist — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Warum die Schweiz reich geworden ist», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Mit dem Unternehmer wurde allerdings auch die wirtschaftliche Abhängigkeit von vielen Menschen zwar keineswegs erfunden, aber doch vertieft und auf eine bemerkenswerte Weise modernisiert. Zugegeben, Abhängige hatte es immer gegeben, ja auf die meisten Menschen traf dies seit Urzeiten zu, frei und unabhängig war so gut wie niemand: Die Kirche stützte sich auf Leibeigene, Klöster besassen Sklaven, der Adel herrschte über Bauern, die ihm Fronarbeit und den Zehnten schuldeten, Königinnen liessen sich bedienen, Bischöfe verwöhnen, und fast jeder Handwerksmeister beschäftigte ein paar Gesellen, während die Meistersfrau über Köchin und Magd kommandierte: Selbst Lohnarbeit war also schon im Mittelalter verbreitet gewesen – und doch führte das Verlagssystem jene spezielle Abhängigkeit von den Unternehmern und den Launen des Marktes ein, die so viele Intellektuelle später als «Ausbeutung» und «Entfremdung» geisseln sollten. Allen voran Karl Marx, der Wegbereiter des Kommunismus.
Und es stimmte ja. Der Heimarbeiter in seinem feuchten Keller, die Heimarbeiterin mit ihren klammen Fingern am Spinnrad waren dem Verleger auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Er bestimmte ihren Lohn – und da es lange Zeit mehr von jenen Leuten gab, die nach einem Nebenverdienst suchten, als Verleger, die nach diesen verlangten, besassen die kleinen Bauern in den engen Tälern und den hinteren Krachen schlechte Karten, um eine bessere Bezahlung für sich herauszuholen. War das nicht ungerecht? Und selbst wenn es sich um ein Verhältnis handelte, das nicht von heute auf morgen so einseitig gewesen war, so steckte im Verlagssystem doch der Keim des Kapitalismus. Kaum war der Verleger auf der historischen Bühne aufgetaucht, stiess er eine Entwicklung an, die auf lange Sicht kaum mehr aufzuhalten war. Lohnarbeit wurde nach ein paar Jahrhunderten im Westen zur Norm, das Kapital, will heissen die Finanzierung, sollte die gesamte Produktion durchdringen, und am Ende hing tatsächlich das Schicksal von zahllosen Arbeitern und deren Familien von den Fähigkeiten eines einzelnen Unternehmers ab – und wenn nicht von diesem allein, dann vom Markt, wo unsichtbare Kräfte über die Wohlfahrt ganzer Völker entschieden. Musste eine solche «kapitalistische Produktionsweise», wie sie Marx nannte, nicht unvermeidlich in die Revolution führen? Marx und mit ihm später Millionen von dessen Anhängern waren überzeugt davon. Es war ein Wirtschaftssystem, das sich leicht denunzieren liess, selbst wenn es sehr viel mehr Wohlstand schuf als jedes andere zuvor.
Zu Anfang, als sich das Verlagssystem in der Textilproduktion herausformte, gab es noch viele selbstständige Spinner und Weber – was damit zusammenhing, dass der Flachs der wichtigste Rohstoff für ihr Produkt darstellte. Flachs wuchs auch in der Schweiz, ja in gewissen Gebieten wie der Ostschweiz sogar besonders gut, und viele Spinner und Weber zogen es daher vor, ihn selbst anzupflanzen, um ihn daraufhin zu Leinwand zu verarbeiten. Für die Rohstoffbeschaffung waren sie auf keinen Verleger angewiesen, sondern dieser kam erst ins Spiel, wenn es darum ging, die fertige Ware zu exportieren. Noch handelte es sich um ein recht egalitäres Auftragsverhältnis.
Als im 16. Jahrhundert jedoch die Baumwolle in Europa auftauchte, ein Rohstoff, der aus dem Nahen Osten oder Indien eingeführt werden musste, nahm die Bedeutung des Verlegers zu. Nun sorgte er auch für den Rohstoff. Zunächst kaufte manch ein Spinner dem Verleger diesen noch ab, um ihm nachher die Ware wieder zu verkaufen. Das überbürdete ihm allerdings ein beträchtliches Risiko: Konnte er ahnen, wie sich die Nachfrage nach seinem Produkt auf dem Weltmarkt in zwei, drei Monaten entwickeln würde? Brach sie ein, blieb der Weber auf seinem Stoff sitzen und konnte ihn nur noch zu tiefsten Preisen losschlagen. Zog die Nachfrage unerwartet an, stand dem Spinner zu wenig Garn zur Verfügung, um aus den höheren Preisen Nutzen zu ziehen. Angesichts der Tatsache, dass er verhältnismässig viel Geld investiert hatte, um sich den Rohstoff zu beschaffen, wird verständlich, warum die Freiheit des Produzenten diesem selbst hin und wieder als eine bittersüsse Freiheit erschien: Fluch und Segen zugleich.
So war es nur eine Frage der Zeit, bis der Verleger dieses Risiko übernahm und die Heimarbeiter zu Lohnabhängigen machte. Nach und nach schwang er sich zum Herrn des gesamten Produktionsprozesses auf. Dabei war nichts entscheidender als der Umstand, dass er diesen auch durchgehend finanzierte. Er stellte das Kapital bereit und gab es nie mehr aus der Hand – er war der Kapitalist. So blieb der Rohstoff, dann das Zwischenprodukt wie etwa das Garn, das der Handspinner herstellte, oder schliesslich das vollendete Tuch, das der Weber ablieferte, stets im Besitz des Verlegers. Heimarbeiter waren Lohnarbeiter, sie wurden nicht als Selbstständigerwerbende betrachtet wie etwa ein Handwerksmeister, der als Schreiner sein Holz bestellte, es daraufhin verarbeitete und schliesslich den neuen Tisch einem Kunden verkaufte. Heimarbeiter besassen ihre Ware nicht, gleichzeitig wurde von ihnen aber oft erwartet, dass sie für Spinnrad, Webstuhl oder anderes Gerät selbst aufkamen, ebenso sorgten sie für ihren Arbeitsplatz, ohne dass der Verleger daran einen Beitrag geleistet hätte – in der Regel diente der Keller oder die Stube im eigenen Bauernhaus als solcher. Wenn Heimarbeit aus Sicht des Verlegers eine gute Einrichtung war, dann lag dies auch daran, dass er auf diese Weise zusätzlich Kosten einsparte. Heute würde man von Outsourcing sprechen.
Gleichwohl zogen auch die Heimarbeiter daraus Nutzen, denn bei aller Not, die sie dazu zwang, sich einem Verleger anzuvertrauen, wurden sie damit auch manch eine Sorge los. Zwar gaben sie ihre Selbstständigkeit auf und tauschten sie für eine manchmal drückende Abhängigkeit ein, dennoch, so scheint es, nahmen sie dies häufig nur zu gerne in Kauf. Von den Schwankungen des Marktes hatten sie wenig zu gewinnen – solange sie so gut wie ungeschützt damit umgehen mussten.
Für den Export zu arbeiten, erforderte Sachwissen, gute Nerven, Kapital und eine Risikofähigkeit, wie sie nur wenigen gegeben war – zumal in jener Epoche, der frühen Neuzeit, wo alles unsicher, alles prekär erschien: Informationen, das Reisen, der Transport, die Kreditbeziehungen, die Eigentumsgarantie, Geld. Dass unter solchen Umständen nur wenige sich in dieses Geschäft vorwagten und dass die meisten, die dies taten, ursprünglich Kaufleute gewesen waren, die sich neuerdings auch in Fabrikanten verwandelten, kann vor diesem Hintergrund nicht überraschen. Zuerst die Kaufleute, dann die Verleger, sie waren die frühen Virtuosen der Marktwirtschaft. Sie gehörten zu den Ersten, die sich der Brutalität der Preisbildung auf dem Markt ausgesetzt hatten, sie waren die Ersten, die die anonyme, mitunter unheimliche Macht von Angebot und Nachfrage für sich ausnutzten – oder daran zerbrachen. Reichtum und Bankrott lagen immer nah beieinander.
Glück und Elend des Verlagssystems
Das Verlagssystem war modern, weil es den Verleger in die Lage versetzte, sehr viel mehr produzieren zu lassen als je zuvor – ob es sich nun um Musikdosen handelte, Strümpfe, Taschen oder eben um Textilien. Der Ausstoss war enorm – besonders im Vergleich zum alten Gewerbe, wo der einzelne Handwerker alles selber machte und sich oft tagelang mit einem einzigen Produkt beschäftigte. Im Verlag dagegen fertigten Tausende von Heimarbeitern rastlos Waren in Mengen, wie das vorher, ob auf dem Bauernhof oder in der Handwerksbude, nicht vorstellbar gewesen war. Die zahllosen Arbeiter, die daran beteiligt waren, bildeten gleichsam ein menschliches Fliessband.
Darin zeigte sich Stärke und Schwäche des Verlagssystems zugleich. Der Faktor Mensch. Denn die Produktivität liess sich nicht unbegrenzt steigern. Noch gab es kaum Maschinen, noch stand die Handarbeit im Vordergrund, und nur wenige Innovationen – wie etwa der Einsatz des Spinnrades anstatt der Spindel – beschleunigten die Produktion. Keine Frage, je erfahrener und tüchtiger die Heimarbeiter waren, desto mehr lieferten sie, und desto schneller stellten sie ihre Ware fertig – ab einem gewissen Punkt war es jedoch nicht mehr möglich, noch mehr von ihnen zu erwarten.10
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Warum die Schweiz reich geworden ist»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Warum die Schweiz reich geworden ist» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Warum die Schweiz reich geworden ist» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.