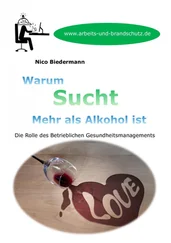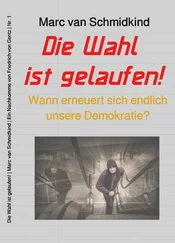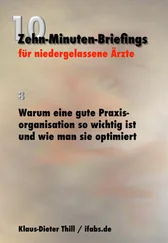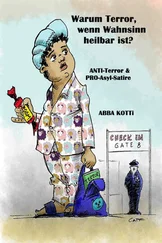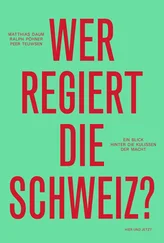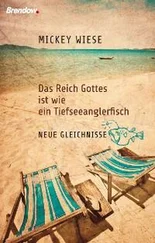Markus Somm - Warum die Schweiz reich geworden ist
Здесь есть возможность читать онлайн «Markus Somm - Warum die Schweiz reich geworden ist» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Warum die Schweiz reich geworden ist
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Warum die Schweiz reich geworden ist: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Warum die Schweiz reich geworden ist»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Warum die Schweiz reich geworden ist — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Warum die Schweiz reich geworden ist», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Vielleicht ist kein Thema in der schweizerischen Geschichte von mehr Belang, und womöglich ist keines unbekannter – was so verblüffend wirkt wie die Tatsache selbst. Bevor ich mich jedoch damit beschäftige, möchte ich diese Industrie des 18. Jahrhunderts beschreiben. Wenigen dürfte die sogenannte Heim- oder Hausindustrie vertraut sein. Sie war ein Wunder, sie war ein Elend – auch in der Schweiz setzte der Kapitalismus mit Licht und Schatten ein.
Kapitalismus im engsten Tal und im hintersten Krachen
Die Schweizer wurden zur Exportnation – und weil sie dem ersten Anschein nach dafür nicht die besten Voraussetzungen mitbrachten, verlegten sie sich auch auf ausgewählte Produkte – und stellten diese auf eine besondere Art her. Sie machten gewissermassen aus der Not eine Tugend. Es gab im Wesentlichen zwei Ansätze.
Der eine ist uns noch heute vertraut: hohe Qualität. Wenn der Export schon so teuer war, aus einem Land der Berge ohne Meer, dann machte es für die Schweizer Sinn, sich auf Dinge zu spezialisieren, die wenig wogen und daher billiger zu verfrachten waren, die aber gleichzeitig im Vergleich zu ihrem Gewicht unendlich viel Wert besassen. Uhren entsprachen diesem Anforderungsprofil bestens, und seit dem 16. Jahrhundert machten sich die Genfer Uhrenmacher deshalb auf, die Weltmärkte zu erobern. Es verging nicht viel Zeit, bis diese ausgesprochene High-Tech-Branche der frühen Neuzeit in die Juratäler ausgriff, nach Neuenburg und in den Berner Jura, bis die Schweizer im 18. Jahrhundert zu den weltweiten Marktführern für Uhren aufgerückt waren, was sie für lange Zeit bleiben sollten. Niemand sah sich in der Lage, so präzise Uhren zu fertigen, niemand traute sich zu, diese winzigen Zaubermaschinen zu übertreffen. Die Schweizer erzielten hohe Preise für hohe Qualität.
Den zweiten Ansatz wandte die Textilindustrie an. Er ist uns weniger geläufig. Leicht und wertvoll und von hoher Qualität waren zwar auch die Textilien, die in der Schweiz hergestellt wurden, nämlich Seide, Stickereien oder feine Baumwollstoffe – darin unterschied sich die Textilbranche nicht grundlegend von der Uhrenindustrie. Doch im Gegensatz zu dieser handwerklich anspruchsvollen Fertigung, wo gut bezahlte Facharbeiter eingesetzt wurden, stützten sich die Textilunternehmer vorwiegend auf Heimarbeiter, die zu sehr tiefen Löhnen spannen und woben. Noch lange sollte dieser Vorzug – aus Sicht der Unternehmer – die schweizerische Industrie prägen und überaus konkurrenzfähig machen, was sich heute, da Schweizer Konzerne längst die höchsten Saläre der Welt anbieten, kaum jemand mehr vorzustellen vermag.
Dass die Löhne so tief lagen, hing damit zusammen, wer für diese frühe Textilindustrie arbeitete, die Bauern und Bäuerinnen in abgelegenen, von der Natur keineswegs verwöhnten Gebieten, wo ihnen feuchte Täler, Hügel, steile Hänge und miserable, steinige Böden das Leben so schwer machten, dass sie dringend auf einen Nebenverdienst angewiesen waren. Die meisten verfügten ausserdem über wenig Land und nur eine geringe Anzahl von Tieren. Zwar lebten sie von der Landwirtschaft, aber mehr schlecht als recht. Die Heimarbeit, die sie für die Textilunternehmer ausführen durften, war kritisch. Ohne sie wären sie wohl verhungert. Und trotzdem blieb es ein Nebenverdienst, den sie in ihrer «Freizeit» neben der Landwirtschaft erzielten, in der Regel zuhause auf ihrem eigenen Bauernhof. Dass es schliesslich für sie ein Nebenverdienst war, kam dem Unternehmer zupass, es ermöglichte ihm, weniger zu bezahlen, als nötig gewesen wäre, wenn diese Arbeiter allein von ihrem Lohn hätten leben müssen.
Was bei oberflächlicher Betrachtung wie eine etwas altertümliche Form der Industrie anmuten mag, nahm in Tat und Wahrheit die Zukunft vorweg – die kapitalistische Zukunft, wo dem Unternehmer und dem Markt eine herausragende Bedeutung zukommen sollte.
Zwar benutzte man noch kaum Maschinen – es wurde von Hand gesponnen, von Hand gewoben, von Hand gebleicht, von Hand veredelt und gestickt, und doch haben wir es mit einer Produktion zu tun, die manch einem Zeitgenossen als revolutionär erschien: Modern war zuallererst die Art und Weise, wie die Arbeit aufgeteilt und vollzogen wurde. Man spricht in der Geschichtsschreibung vom «Verlagssystem», von einer Organisationsform, wo manchmal Hunderte von Arbeitern für einen einzigen Unternehmer tätig waren, in der Regel als Heimarbeiter, meistens auf dem Land, seltener in der Stadt. Wenn es Fabriken gab, dann einzig, um hier die anspruchsvollsten Veredelungsschritte am Produkt vorzunehmen, dafür stellten die Unternehmer ein paar Spezialisten ein. Heimarbeiter dagegen arbeiteten immer daheim, in ihren vier eigenen Wänden, wie der Begriff verrät.
Sie bekamen von ihrem Auftraggeber die Rohstoffe, manchmal auch die Halbfabrikate geradewegs nach Hause geliefert, wo sie sie in einem bestimmten Zeitraum verarbeiteten, nach dem die Ware wieder abgeholt wurde. In der Textilindustrie dauerte dies ein bis zwei Wochen, in der Uhrenindustrie zuweilen ein halbes Jahr. Die Heimarbeiter erhielten dafür einen Lohn, und ihre Erzeugnisse gingen überwiegend in den Export. Sie stellten Massengüter für einen Massenmarkt her. Auch das wirkt aus heutiger Sicht modern.
Der Begriff Verlagssystem geht auf die Tatsache zurück, dass die Unternehmer ihren Arbeitern den Rohstoff, manchmal auch das Arbeitsgerät «vorlegten», auslegten oder vorschossen; deshalb wurden diese Unternehmer auch Verleger genannt – mit den Verlegern der Gegenwart, also jenen Leuten, die einen Verlag betreiben, um Bücher auf den Markt zu bringen, hatten sie nichts zu tun.
Die Verleger stellten eine Kreuzung von Fabrikanten und Kaufmann dar. Die meisten Verleger des 18. Jahrhunderts waren in der Textilindustrie tätig. Es gab indessen auch solche, die Uhren, Musikdosen, Waffen, Spielzeug, Mützen, Strümpfe oder Taschen herstellen liessen. Und die Mehrheit, das ist genauso wesentlich, befand sich in der Stadt, während die Mehrheit der Leute, die für sie tätig waren, eben auf dem Land wohnte und dort für sie arbeitete. Häufig sicherten vorteilhafte Gesetze die starke Stellung der städtischen Verleger ab, manchmal hatten sie sich gar ein Monopol für ihre Geschäfte geben lassen. Die städtischen Räte sorgten für ihre städtischen Unternehmer – nicht immer, aber oft genug.
In der Kreuzung von Fabrikanten und Kaufmann liegt wohl die folgenreichste Innovation des Verlagssystems, wenn man an den späteren Siegeszug des Kapitalismus denkt. Es wurde ein neuer wirtschaftlicher Typus geboren, der Unternehmer – für die einen ein Held oder gar ein «Titan», wie ihn der Ökonom Joseph Schumpeter beschreiben sollte, für die anderen das Böse schlechthin, der «Bourgeois», der Robber-Baron, wie ihn die Amerikaner denunzierten, ein Raubritter, der Bonze.
Eine Kreuzung von historischer Tragweite ohne Frage: Während der herkömmliche Kaufmann, wie man ihn seit der Antike kannte, in erster Linie Rohstoffe und Waren kaufte, lagerte, lieferte und verkaufte, wagte sich der jetzt als Verleger auftretende Unternehmer auch in die Produktion vor, ja am Ende unterwarf er sich die gesamte Wertschöpfungskette, sofern ihm das gelang.
Der Verleger kaufte den Rohstoff ein, liess ihn verarbeiten und verschickte das Produkt in die Welt hinaus. Um dazu in der Lage zu sein, musste er alles wissen, was den Kaufmann schon immer ausgezeichnet hatte – und manches darüber hinaus: Er durchschaute den Markt, wusste, wo man den billigsten und besten Rohstoff erhielt, hatte aber auch Kenntnis davon, was die Kunden sich wünschten, manchmal bevor diese selbst das erahnten; der neue Unternehmer kannte sich aus in Mode, Stil und Qualität und überblickte Angebot und Nachfrage. Indem er Rohstoffe aus aller Welt bezog und nach überallhin exportierte, glich der Verleger dem Fernhändler des Mittelalters. Wenn er sich aber von diesem Kaufmann deutlich abhob, dann darin, dass er eben auch über Produktionsmethoden, Arbeitskräfteangebot oder später Maschinen im Bilde sein musste. Wer als Verleger zu Erfolg gelangen wollte, kam nicht umhin, sich zum Universalgenie in Sachen Profit auszubilden. Er wagte viel, er wagte alles. Einmal stürzte er in die Hölle ab, das andere Mal stieg er in den Himmel auf: Wo immer er aber endete, meistens hatte er in der Zwischenzeit keinen Stein auf dem anderen gelassen. Wahrscheinlich trieb niemand die wirtschaftliche, aber auch gesellschaftliche Umwälzung des Westens im Zeichen von Industrie und Kapitalismus mehr voran als der moderne Unternehmer. Wie kein anderer stand er für die «schöpferische Zerstörung», wie Schumpeter den wirtschaftlichen Strukturwandel später charakterisierte.9
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Warum die Schweiz reich geworden ist»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Warum die Schweiz reich geworden ist» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Warum die Schweiz reich geworden ist» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.