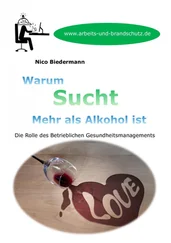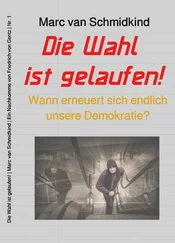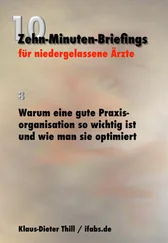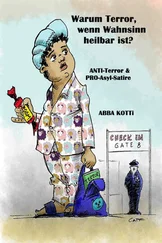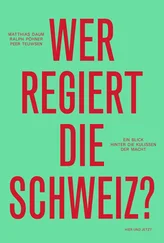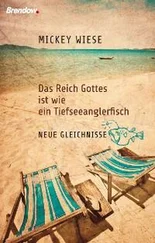Markus Somm - Warum die Schweiz reich geworden ist
Здесь есть возможность читать онлайн «Markus Somm - Warum die Schweiz reich geworden ist» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Warum die Schweiz reich geworden ist
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Warum die Schweiz reich geworden ist: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Warum die Schweiz reich geworden ist»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Warum die Schweiz reich geworden ist — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Warum die Schweiz reich geworden ist», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Nirgendwo aber war die Wirtschaft wohl stürmischer gewachsen als im Glarnerland, in einem von der Natur ungnädig behandelten, faktisch aus wenig mehr als einem einzigen Tal bestehenden Minikanton: 1794 belief sich die Glarner Bevölkerung auf rund 22 000 Einwohner. Davon waren sage und schreibe zwei Drittel in der Industrie tätig, bloss ein Drittel kümmerte sich noch um die traditionelle Landwirtschaft. Damit gehörte Glarus im 18. Jahrhundert zu den am meisten industrialisierten Regionen der Welt.
Vorangegangen war ein aussergewöhnlicher, ja überstürzter Strukturwandel: Seit undenklichen Zeiten hatten sich die Glarner der Viehzucht, der Alpwirtschaft und den Solddiensten für fremde Staaten gewidmet, doch Anfang des 18. Jahrhunderts war zuerst die Baumwollspinnerei, dann der Zeugdruck aufgekommen, also das Bedrucken von Textilien, wofür die Glarner Unternehmer schliesslich weltberühmt werden sollten. Wie so oft hatte die Industrialisierung gleichzeitig eine markante Zunahme der Bevölkerung bewirkt: Im 14. Jahrhundert dürften bloss 4000 Menschen im Glarnerland gelebt haben. 1700 war ihre Zahl auf 10 000 angestiegen, um sich bis 1794 mehr als zu verdoppeln. Mit anderen Worten, in knapp hundert Jahren war der Kanton so stark gewachsen wie in den vorhergehenden dreihundert Jahren zusammen.
«Diese Bevölkerung», stellte Johann Gottfried Ebel, ein deutscher Besucher, 1797 fest, «steht in keinem Verhältnis mit den nutzbaren Grundstücken des Landes, und man kann daher mit Recht sagen, dass der Kanton Glarus für seine Bewohner zu klein ist.»4 Ebel stammte aus Preussen; von der Ausbildung her ein Arzt, bereiste er in den 1790er Jahren wiederholt die Schweiz und verfasste Reiseberichte, die dem ausländischen, besonders dem deutschen Touristen das Alpenland näherbringen sollten. Ebel fuhr fort: «Mit der Einführung neuer Erwerbszweige [der Textilindustrie] wurden die Ehen häufiger und fruchtbarer, die Güter der Familien zerfielen in kleinere Teile und deren Zerstückelung erreichte bei steigender Menschenvermehrung den höchsten Grad.»5
Wenn man bedenkt, dass zu jener Zeit die Linthebene, jenes weite Gebiet zwischen Walen- und Zürichsee, das den Zugang zum Glarnerland beherrscht, noch nicht entsumpft und melioriert war, wird deutlich, als wie aussergewöhnlich die Frühindustrialisierung in diesem abgeschnittenen Tal mitten im Gebirge zu beurteilen ist. Der Sumpf erschwerte den Verkehr von Personen und den Transport von Gütern, der Sumpf begünstigte auch die Malaria, die regelmässig ausbrach und die Menschen heimsuchte. In der Tat: Das Glarnerland war ein verwunschener Ort. Ein Krachen, von dem man zuletzt erwartet hätte, dass er sich je zu einem so bedeutenden Standort der Textilindustrie heranbilden würde. Ein Wunder, ein Zufall? Weder das eine noch das andere.
Verwunschen, abgeschnitten, vom Schicksal bestraft: Das Gleiche lässt sich von einem zweiten Minikanton in den Voralpen sagen, dessen Entwicklung nicht weniger verblüffend verlaufen war: Appenzell Ausserrhoden hatte sich im 18. Jahrhundert ebenfalls zu einem Schwerpunkt der Textilindustrie verwandelt. Von den 35 000 Menschen, die seinerzeit dort lebten, arbeiteten 11 000 für den Export von Stoffen, nur eine Minderheit fand noch in der Landwirtschaft ihr Auskommen. Wenn Appenzell Ausserrhoden auch das eindrücklichste Beispiel der Industrialisierung in der Ostschweiz darstellte, so war es doch keine Ausnahme: Ob Toggenburg, Fürstenland, Thurgau oder das Rheintal: Überallhin hatte sich die Textilindustrie ausgedehnt, in konzentrischen Kreisen war sie jedes Jahr gewachsen, und in der Mitte lag die Stadt St. Gallen, wo die Unternehmer residierten, die dieses Geschäft – Import, Produktion und Export – im Wesentlichen dirigierten. Hatten die St. Galler zuerst jahrhundertelang die Leinenindustrie des gesamten Bodenseeraumes dominiert, waren sie zu Anfang des 18. Jahrhunderts auf die Baumwolle umgestiegen, dann erfanden sie die Stickerei, die sie bis zum Ersten Weltkrieg überaus reich machen sollte. Allein im stockkatholischen Appenzell Innerrhoden rührte sich wenig. Hier gab es kaum Industrie.
Last, but not least hatte sich in der Schweiz, insbesondere in Genf und Neuenburg, eine weitere Industrie etabliert, die das Land bis auf weiteres ebenso prägen sollte: die Uhrenindustrie, deren Produkte in ganz Europa auf beachtlichen Absatz stiessen. 10 000 Uhrmacher gingen in der Westschweiz dieser Tätigkeit nach – die kaum jemand sonst beherrschte.
Die Schweiz, ein Industriestaat avant la lettre. Für die spätere Geschichte des Landes sollte sich dieser sehr frühe Start als ausserordentlich folgenreich herausstellen. Gewiss, das war keine Industrie, wie wir uns das heute vorstellen. Noch fehlten weitgehend die Maschinen, es überwog Handarbeit, ebenso trug sich der grösste Teil der Produktion in der Heimindustrie zu: Tausende von Heimarbeitern, kleine Bauern und Bäuerinnen im Nebenberuf, stellten die Textilien auf ihren Höfen her, selbst die meisten Uhrmacher tüftelten, schliffen und schraubten zuhause; Fabriken, wie wir sie kennen, kamen selten vor.
Es hatte eine «Industrialisierung vor der Industrialisierung» stattgefunden, wie die Wirtschaftshistoriker diesen Wandel heute in Worte fassen. Die Menschen bewegten sich zwischen agrarischem Gestern und industriellem Morgen, im rasenden Stillstand sozusagen, was sich im Fall der Schweiz allerdings als entscheidender Vorzug erweisen sollte. Die Schweiz galt als ein Pionier dieser sogenannten Protoindustrie, deshalb wuchs sie auch zum Pionier der darauffolgenden industriellen Revolution heran.
Zwar sahen sich lange nicht alle Kantone in der damaligen alten Eidgenossenschaft von dieser Entwicklung betroffen. In manchen war die Zeit stehen geblieben, und man lebte dort, als wäre das Mittelalter nie vergangen. Wo die Industrie sich aber festgesetzt hatte, und das waren eben doch viele Regionen, brach eine neue Ära an. Alles wurde anders, vieles modern, den meisten ging es besser, lange bevor die Französische Revolution von 1789 ganz Europa aus den Angeln heben sollte.
Den meisten Zeitgenossen war dies bekannt, zumal sie wie etwa der oberste französische Zollinspektor Jacques Savary mit den Folgen dieses Wirtschaftswunders zu tun hatten. Später geriet dieser vorzeitige Durchbruch in Vergessenheit, wie der deutsche Soziologe Ulrich Menzel feststellte: «Der Blick der Wirtschaftshistoriker, die sich mit den Anfängen der Industrialisierung beschäftigen, richtet sich in erster Linie auf England»6, und wenn auf den Kontinent, dann allenfalls auf Frankreich: «Dabei wird vielfach übersehen, dass zumindest in dem Leitsektor der frühen Industrialisierung, der Textilindustrie, die Schweiz im dritten Viertel des 18. Jahrhunderts das führende Land in Europa war und zwischen 1750 und 1780 eine erste Hochkonjunktur erlebte.»7 Mit Blick auf die Konkurrenz kommt Menzel zum Schluss: «Die schweizerische Baumwollindustrie ist älter als die englische und die Seidenindustrie älter als diejenige Lyons.»8
Wie war das möglich? Auf den ersten Blick gab es vielleicht kein Land in Europa, dem man einen solchen wirtschaftlichen Aufstieg weniger zugetraut hätte als der Schweiz. War es nicht ein Land mitten im Gebirge, wo es zu allem Elend nicht einmal Gold oder Silber oder Eisenerz gab wie in so vielen Bergregionen der Welt? Hätten die Schweizer wenigstens ein paar Rohstoffe aus ihren Felsen brechen können, wären sie wohl der Natur in einer besseren Position gegenübergestanden, stattdessen fanden sie nur Schutt, fettes Gras, Moos und Flechten. Sie bissen buchstäblich auf Granit.
Sie lebten überdies in einer Eidgenossenschaft der Isolation, ohne Meeranschluss, ohne Seehäfen, zwar mit Flüssen versehen, die sich allerdings nur teilweise mit Schiffen befahren liessen. Wer exportieren wollte, war stets auf die Gutmütigkeit seiner Nachbarn angewiesen. Zwei Drittel des Landes lagen in den Alpen oder im Jura, in unfruchtbarem und unwegsamem Gebiet. Das eine hintertrieb eine produktive Landwirtschaft, das andere erschwerte den Transport von Waren und machte ihn vor allen Dingen kostspielig, unzuverlässig und langsam. Wie konnte es sein, dass sich ausgerechnet diese Schweiz zum Standort einer leistungsfähigen Exportindustrie entwickelt hatte?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Warum die Schweiz reich geworden ist»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Warum die Schweiz reich geworden ist» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Warum die Schweiz reich geworden ist» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.