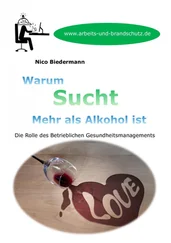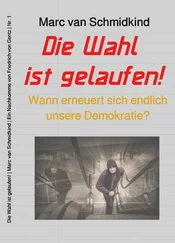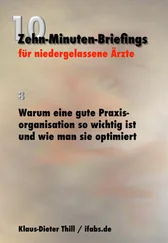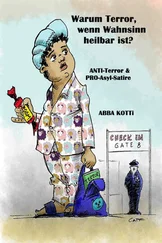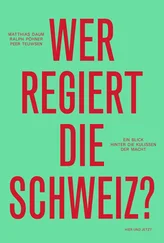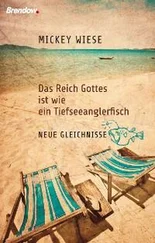Markus Somm - Warum die Schweiz reich geworden ist
Здесь есть возможность читать онлайн «Markus Somm - Warum die Schweiz reich geworden ist» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Warum die Schweiz reich geworden ist
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Warum die Schweiz reich geworden ist: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Warum die Schweiz reich geworden ist»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Warum die Schweiz reich geworden ist — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Warum die Schweiz reich geworden ist», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
In der Regel fuhr er nicht selbst nach Italien, um seine Seide zu holen, sondern er setzte auf Spediteure, die er gut kannte, wie etwa die Firma Paravicini in Chiavenna oder Huber in Walenstadt. Sie erledigten den Transport. Sie packten die Seide in Bergamo und Verona auf Kutschen, verluden sie aufs Schiff, wo immer ein Fluss oder ein See sich als Transportweg anbot, und nutzten diesen einzigen wirklich bequemen Verkehrsweg so lange als möglich, bis es in die Berge ging, wo man nur mehr mit Maultieren vorwärtskam. Rund zwei Wochen später traf die Ware in Zürich ein. Hier gab sie Gossweiler sogleich an seine zahlreichen Arbeiter weiter, die allerdings nicht in Zürich tätig wurden, sondern in Männedorf und Stäfa. Es waren Bauern, die nebenbei in ihren Kellern Seide spannen und woben. Heimarbeiter nannte man sie: Männer, Frauen, oft Kinder, die gegen einen geringen Lohn die rohe Seide in weiches, kostspieliges Tuch verwandelten. Kaum hatten sie ihre Arbeit verrichtet, tauchte ein Mitarbeiter von Gossweiler auf, sammelte die fertige Ware ein und spedierte sie per Schiff nach Zürich zurück. Von hier aus verschickte sie Gossweiler in alle Welt: nach Frankreich, nach Spanien, nach Holland, nach Frankfurt und Leipzig, ja selbst nach Russland und Nordamerika. Gossweiler, der sich wohl zu Recht als den besten Seidenspinner von Zürich bezeichnete, betrieb ein hochrentables Unternehmen. Dabei erwarb er sich ein Vermögen und Respekt, sein Geschäft war kapitalistisch und globalisiert, als es diese Begriffe noch gar nicht gab.
Hans Conrad Gossweiler lebte von 1694 bis 1760 in Zürich. Er war ein typischer Kaufmann und Fabrikant dieser Stadt, wie es damals im 18. Jahrhundert viele gab, ja Zürich war dank ihnen zu einer der reichsten Städte Europas aufgestiegen – was man zwar nicht gerade zur Schau stellte, aber im Stillen sehr wohl genoss. Wie Gossweiler produzierten die Zürcher Fabrikanten Seidenstoffe, zunehmend auch solche aus Baumwolle, sie importierten aus Italien, aus dem Nahen Osten oder aus der Karibik ihre Rohstoffe, liessen sie auf dem Land von Heimarbeitern veredeln und lieferten ihre Waren in alle Herren Länder.
Es hatte sich ein Wirtschaftswunder zugetragen, das auch die Zeitgenossen verblüffte. Es war eine kapitalistische Zitadelle entstanden in einem Europa, wo die meisten Menschen noch als Bauern ihr Leben fristeten – mehr schlecht als recht, nur knapp sich über dem Subsistenzniveau durchbringend, was sie erwirtschafteten, brauchten sie sogleich auf. Jede Missernte, jeder Krieg stürzte sie in Not, es drohte der Hungerstod. Im Kanton Zürich kam das ebenfalls vor, doch immer seltener. Bald schien es undenkbar.
1723 war in Paris ein «Lexikon des Handels» erschienen, wo alle wichtigen Länder und Städte der damaligen Weltwirtschaft behandelt wurden. Der Autor hiess Jacques Savary des Brûlons. Unter dem Stichwort «Zurich» hatte er geschrieben: «Die Zürcher haben aus ihrem Staat ein veritables Peru gemacht, obwohl sie über keinerlei Gold- oder Silberminen verfügen»1, womit Savary sehr viel Reichtum andeutete, denn Peru galt dank seiner Minen als ein Land von unermesslichen Schätzen. Es gehörte zu jener Zeit den Spaniern. «Doch im Gegensatz zu den harten Spaniern, die aus Peru so viel Gold und Silber herausgezogen haben, was sie auf Kosten des Blutes der armen Indianer taten, die sie in den Minen zur Arbeit zwangen, haben die Herren von Zürich ihren Staat und ihre Untertanen allein mit ihren Fabriken reich gemacht.»2 Savary musste es wissen. Er war hauptberuflich Generalinspektor des französischen Zolls und hatte die vielen Waren aus Zürich zu kontrollieren, die in Frankreich auftauchten.
Zürich stand nicht allein, ganz im Gegenteil, seit gut einem Jahrhundert hatte sich in vielen Regionen der damaligen Schweiz – der sogenannten alten Eidgenossenschaft – immer mehr Industrie ausgebreitet. Ob in Basel oder Genf, ob in St. Gallen und der gesamten Ostschweiz, in Glarus, im Aargau: Überall war die Industrie gewachsen, bis sie, im Ausland lange kaum beachtet, im 18. Jahrhundert europäische Dimensionen angenommen hatte. Diese Schweiz des Ancien Régimes, wie man sie später auch bezeichnen sollte, ein merkwürdiges Relikt aus dem Mittelalter, erwies sich zugleich als eines der modernsten Länder, was seine Wirtschaft anbelangte.
Um 1780 war es zum wichtigsten Zentrum der europäischen Textilindustrie aufgestiegen. In diesem Jahr betrug der schweizerische Export 3 Millionen £, im Jahr 1800 5 Millionen £, was in beiden Fällen etwa zwei Prozent des gesamten Welthandels entsprach.
Wenn wir uns vor Augen halten, dass die Weltbevölkerung sich zu jener Zeit auf etwa eine Milliarde Menschen belief und die Eidgenossenschaft bloss 1,7 Millionen Einwohner davon beherbergte, wird deutlich, als wie überproportional wir diesen schweizerischen Anteil am Welthandel einzuschätzen haben: 1,7 Millionen sind 0,17 Prozent im Verhältnis zu einer Milliarde, die Schweizer lieferten also mit zwei Prozent rund zwölf Mal mehr Waren, als ihre Bevölkerungszahl hätte annehmen lassen. Was für eine erstaunliche Exportleistung – besonders für ein Land, das in den Augen der meisten Europäer noch kurz zuvor nur eines zu exportieren gewusst hatte: die brutalsten und teuersten Söldner der Weltgeschichte. Doch im 18. Jahrhundert sah alles anders aus. Aus einer Nation der Söldner war ein Land der Fabrikanten, Kaufleute und Arbeiter geworden.
Der Umfang dieser frühen Industrie war gewaltig. Die Behörden des Kantons Zürich hatten im Jahr 1787 alle Arbeitskräfte zählen lassen, die in der Baumwollindustrie untergekommen waren. Es handelte sich um den führenden Sektor. Man ermittelte 34 000 Spinner und nahezu 6500 Weber, insgesamt arbeiteten wohl 50 000 Menschen in der Produktion von Baumwollstoffen, was einem Drittel aller Arbeitskräfte im Kanton entsprach. Angesichts der Tatsache, dass ausserdem 4000 Leute in der Seidenherstellung ihr Geld verdienten, kann man ermessen, wie ausgeprägt sich der Kanton Zürich schon industrialisiert hatte. Alles in allem betrug dessen Bevölkerung 1792 rund 175 000 Einwohner.
Ähnlich sah es in den übrigen Industrieregionen aus. So wurden im Aargau etwa zur gleichen Zeit rund 30 000 bis 40 000 Leute registriert, die in der Baumwoll- und in der Leinenweberei tätig waren, was ebenfalls einem Drittel der Erwerbsbevölkerung gleichkam; der heutige Kanton gehörte damals zu weiten Teilen zu Bern.
Auch Basel zählte zu diesen produktiven, modernen Gebieten, allein im Kanton, der damals sowohl Basel-Stadt als auch Baselland umfasste, standen über 2300 Webstühle, auf denen das allerseits begehrte, exquisite Seidenband hergestellt wurde. Längst hatte sich diese Luxusbranche ebenso ins Elsass, in das Badische und in das Fricktal ausgedehnt.
Seidenbänder stiessen zu jener Zeit auf eine stabile Nachfrage, besonders der Adel verbrauchte sie in rauen Mengen, um sich standesgemäss zu schmücken oder aufzuputzen, wie man das nannte. Ob am Hut oder am Kleid, an den Strümpfen oder am Hemd: Nie durfte ein Seidenband fehlen. Paris, die neue Hauptstadt der Mode, liebte Basel. Basel liebte Paris.
Dass ausgerechnet das protestantische Basel sich an diesem Luxusprodukt bereicherte, entbehrte nicht der Ironie, denn die Politiker und Pfarrer der Stadt taten alles, um den eigenen Bürgern mit strikten Sittenmandaten das Seidenband zu verleiden; nur sehr eingeschränkt war dessen Einsatz erlaubt. Man exportierte nach Frankreich, was man selbst nicht benutzen durfte. Nicht alle hielten sich daran.
«Die alten Sittengesetze Basels», hiess es in einem Lexikon des 19. Jahrhunderts, «waren von merkwürdiger Strenge. So mussten sonntags alle in schwarzen Anzügen zur Kirche gehen, Frauen und Mädchen durften sich das Haar nicht von Männern ordnen lassen, nach zehn Uhr abends wurden keine Wagen in die Stadt gelassen, und niemand durfte einen Bedienten hinten auf seinem Wagen haben. Mit der Frömmigkeit ging aber der ‹Handelsgeist› Hand in Hand, und Basel ist deshalb auch ‹Wucherstadt› genannt worden. Fünf Prozent galt als mindester ‹christlicher Zins›, und wer seine Kapitalien zu geringerem Zinsfuss auslieh, wurde als staatsgefährlich verfolgt.»3
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Warum die Schweiz reich geworden ist»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Warum die Schweiz reich geworden ist» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Warum die Schweiz reich geworden ist» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.