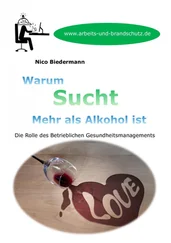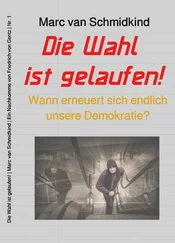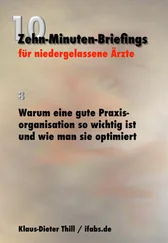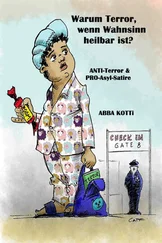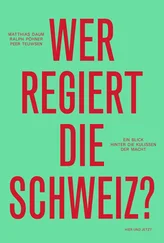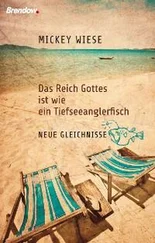Markus Somm - Warum die Schweiz reich geworden ist
Здесь есть возможность читать онлайн «Markus Somm - Warum die Schweiz reich geworden ist» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Warum die Schweiz reich geworden ist
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Warum die Schweiz reich geworden ist: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Warum die Schweiz reich geworden ist»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Warum die Schweiz reich geworden ist — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Warum die Schweiz reich geworden ist», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Über Filippo Orell, den Grempler, hiess es im Bericht: «Ist viel im Welschland, hat bisher Zwilch und Leder nach Mailand ausgeführt und dafür Reis eingetauscht.» Auch Andrea Cevio hatte sich in der lombardischen Hauptstadt mit Waren eingedeckt, namentlich: «Seide, Samt, Schürlitz [Barchent], Barett, Schlappen, Federn und anderen Kram», im Winter kaufte er überdies «Würste, Kerzen und Käse aus Piacenza» ein.
Für den weiteren Verlauf der schweizerischen Wirtschaftsgeschichte stellten sich aber nicht diese Kerzen, Würste oder Seifen als folgenreich heraus, die die Locarner aus Italien zurückbrachten, sondern die beiden textilen Rohstoffe Baumwolle und Seide. Denn über kurz oder lang beschränkten sich die Locarner nicht auf den Handel. Bald nahm sich der eine oder andere die Produktion vor. Sie riefen Betriebe ins Leben, um in Zürich Baumwolle oder Seide zu Stoffen zu verarbeiten. Es war der Beginn einer neuen Ära.
Ein Bombengeschäft
Zwar hatte es in Zürich im Mittelalter schon einmal ein berühmtes Seidengewerbe gegeben, und auch die Tüchli-Herstellung aus Baumwolle hatte sich verbreitet, bevor die Tessiner Flüchtlinge aufgetaucht waren – doch die Seidenindustrie war im 15. Jahrhundert spurlos verschwunden, während die Tüchli-Branche nie über den Stellenwert eines unzünftigen Handwerks hinauskam, wo die Einheimischen in der Regel für den engen, lokalen Markt tätig waren. Selten gelangte ein Tüchli weiter als bis nach Zurzach oder St. Gallen.
Von einem Geschäft im üblichen Sinne, von Renditen, von wachsenden Umsätzen dank wachsender Exporte konnte keine Rede sein – bis die Locarner kamen. Sie machten aus dem biederen Tüchli-Handel ein glänzendes Geschäft. Ein Bombengeschäft.
Dass die Zürcher das nicht selber fertiggebracht hatten, sondern gewissermassen auf die Locarner warteten, bis diese das für sie erledigten, lag nicht an Unfähigkeit oder an einem Mangel an Vorstellungskraft. Vielmehr waren diverse Schwierigkeiten zu überwinden – wofür man heute im Zeitalter des scheinbar grenzenlosen Onlinehandels, wie er von Giganten wie Amazon oder Zalando betrieben wird, kaum mehr Verständnis aufbringen mag.
Es lohnt sich indes, sich auf die Details einzulassen, weil so die Leistung der Tessiner umso besser eingeschätzt werden kann. Wir befinden uns in der frühen Neuzeit. Italien lag so weit weg wie heute womöglich Amerika. Konkret sahen sich die Zürcher Tüchli-Produzenten mit diesen Engpässen konfrontiert: Bevor die Locarner mit ihren Kenntnissen über Italien in Zürich den Nord-Süd-Handel an sich brachten, waren es italienische Kaufleute gewesen, die die Zürcher mit Rohbaumwolle versorgt hatten. Mehr schlecht als recht. Der Handel kam nie wirklich in Schwung. Denn so wie die Italiener die Schweizer kaum verstanden, so begriffen die Schweizer die Italiener nicht. Wenn die Schweizer überhaupt etwas wussten, dann hatten sie das in der Regel als Söldner gelernt, indem sie die Italiener auf einem Schlachtfeld massakriert oder deren Land geplündert hatten – nicht der allerbeste Ansatz, um Leute als Kunden und Lieferanten zu gewinnen. So wie die Italiener in Zürich herumirrten, so standen die Schweizer vor geschlossenen Türen, wenn sie in Italien etwas einkaufen oder absetzen wollten.
Es stockte der Verkehr, es brachen die Verbindungen ab. Allzu häufig herrschte Stillstand sowohl im Norden als auch im Süden, zumal es den Italienern allein schon schwerfiel, den Transport der Ware zu organisieren.
Darüber hinaus, und das stellte den zweiten Engpass dar, vermochten die Italiener in der Schweiz wenig zu entdecken, was sie mit Profit im reichen Italien hätten abstossen können. Die beiden wichtigsten und wirklich gefragten Exportprodukte, welche die Schweizer bisher nach Italien geliefert hatten – Söldner und Kühe –, begaben sich sozusagen von selbst dorthin. Niemand musste sie abholen. Ausserdem waren es die Schweizer in den Voralpen, die sich auf die Viehzucht konzentrierten, nicht die Zürcher.
Bis die Locarner auf den Plan traten, gestaltete sich der Zürcher Handel mit Italien deshalb recht einseitig: Die Schweizer verlangten nach Importen, waren aber kaum in der Lage, dafür zu zahlen – oder eigene Produkte zum Tausch anzubieten. Es brauchte den frischen Blick der Locarner. Dass sie die Tüchli als potenzielle Exportartikel erkannten, hatte zweifellos damit zu tun, dass sie um jeden Preis etwas finden mussten, das in Italien auf eine Nachfrage stiess. Ihre Existenz hing davon ab.
Oft war Baumwolle vorher in Zürich schwer aufzutreiben gewesen, und die Spinner sassen untätig herum. Oder es gab Baumwolle, aber der Preis überstieg ihre Möglichkeiten. Es fehlte das nötige Kapital. Wie konnte es anders sein? Wie kam ein kleiner Bauer im Säuliamt an so viel Bargeld heran? Das war der dritte Engpass. Und weil die Weber sich ebenso ausserstande sahen, für das Garn allzu viel Geld vorzuschiessen, ergab sich ein vierter Engpass, der die Produktion begrenzte und damit den Export erschwerte.
Manchmal griffen die Tüchli-Weber zu einem Mittel, das die Behörden gar nicht goutierten, weil es die Armut eher verschärfte denn linderte: Die Tüchli-Weber kamen auf die Idee, ihre Spinner anstatt mit echtem Geld mit «Blechzeichen» zu bezahlen, Pseudomünzen aus wertlosem Metall, das diese ihrerseits verwendeten, um sich bei einem Krämer mit dem Allernötigsten einzudecken. So weit, so gut, aber irgendwann reichte der Krämer dieses Spielgeld an die Weber zurück, sobald er ihnen ein Tüchli abkaufte, und die blieben buchstäblich auf ihrem Schrott sitzen. Wohlstand wurde so kaum geschaffen.
Erst die Locarner brachten eine Wende; eine Wende zum Kapitalismus zwar, aber eine, die wohl kaum ein Tüchli-Weber bedauerte. Ehe er sich’s versah, arbeitete er für den Weltmarkt. Die vielen Engpässe, die ihn früher daran gehindert hatten, mehr Tüchli herzustellen, waren wie vom Erdboden verschwunden. Die Locarner sicherten den Spinnern und Webern den Import ihrer Rohstoffe ab, die Locarner schossen das nötige Kapital vor und verfrachteten die Tüchli nach Italien – ja bald nach überall hin.
Und geradeso wie sich die Locarner bei der Auswahl der Rohstoffe, bei der Organisation eines länderübergreifenden Fernhandels oder dem Aufbau von Handelsgesellschaften an italienische Vorbilder gehalten hatten, taten sie dies auch, als sie in die Produktion vorstiessen. Was sie aus ihrer Heimat oder besser gesagt aus Italien kannten, übertrugen sie nach Zürich. Dazu gehörte das Verlagssystem, was insofern ironisch ist, als in Locarno selbst überhaupt keine derartigen Betriebe vorhanden gewesen waren. Dort hatte niemand Stoffe aus Baumwolle oder Seide produziert. Ulrich Pfister stellt fest: «Durch den Export von Tuchen ins Haupteinkaufsgebiet von Rohbaumwolle und Rohseide [Italien] wurde einerseits die Herausbildung des Verlagssystems in der Baumwollverarbeitung und damit seit etwa 1590 die wesentlich rasantere Entwicklung dieser Branche im Vergleich zur Leinwandherstellung begünstigt. Andererseits erleichterte der ‹Tüchli›-Export die Entstehung der Seidenindustrie dadurch, dass er am Ort des Rohwareneinkaufs den Abschluss von Gegengeschäften möglich machte.»29
Keiner stürzte sich entschlossener in dieses Geschäft als Evangelista Zanino. Er war ein Flüchtling aus Locarno, den es ebenfalls nach Zürich verschlagen hatte. Keiner verdiente so viel, keinem stieg es so in den Kopf, keiner endete so tragisch. Zuerst ein Zauberer des Profits, dann ein Unternehmer einer neuen Ära, schliesslich ging er bankrott.
Doch schuf er wie kaum ein Zweiter die Grundlagen für den Aufstieg einer Stadt – seiner Stadt. 1567 erhielt er als erster Locarner das Zürcher Bürgerrecht. Nicht weil die Zürcher ihn so geliebt hätten, sondern ihnen vor Hass nichts anderes übriggeblieben war.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Warum die Schweiz reich geworden ist»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Warum die Schweiz reich geworden ist» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Warum die Schweiz reich geworden ist» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.