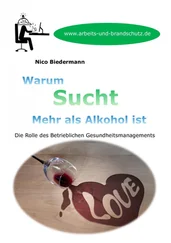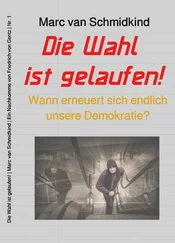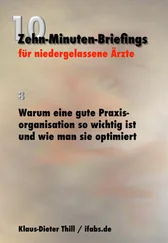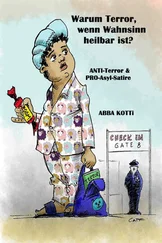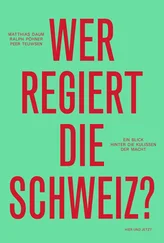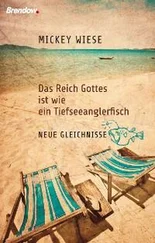Markus Somm - Warum die Schweiz reich geworden ist
Здесь есть возможность читать онлайн «Markus Somm - Warum die Schweiz reich geworden ist» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Warum die Schweiz reich geworden ist
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Warum die Schweiz reich geworden ist: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Warum die Schweiz reich geworden ist»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Warum die Schweiz reich geworden ist — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Warum die Schweiz reich geworden ist», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Wahrscheinlich zerbrachen sie sich für nichts und wieder nichts den Kopf, denn die Locarner, die nun nach Mailand fuhren, hatten anderes im Sinn als die Religion: Ohne Handel mit Italien wären sie in Zürich untergegangen. Jetzt aber, unter diesen günstigen Umständen, erschlossen sie nicht bloss den Zürchern, sondern den Schweizern insgesamt eine neue Welt.
Ein Zweites kam dazu. Vielleicht weil sie Aussenseiter waren, erkannten die Locarner Möglichkeiten, die die Zürcher bisher ausser Acht gelassen hatten. Denn neben dem reichen, aber unsicheren Italien gab es ja noch andere Märkte in Europa, insbesondere Frankreich, dessen gigantische Bevölkerung jeden Kaufmann anziehen musste. Und wer sich auskannte, wusste, dass gerade dieser Markt niemandem offener stand als den Eidgenossen.
Vor gut dreissig Jahren, 1521, hatten die eidgenössischen Orte mit Frankreich einen überaus vorteilhaften Soldvertrag abgeschlossen: Indem sie dem König fast exklusiv das Recht einräumten, in der Schweiz Söldner zu werben, bekamen sie als Gegenleistung zahlreiche wirtschaftliche Vergünstigungen. So wurde zwischen den beiden Ländern der freie Handel eingeführt, Schweizer Kaufleuten gewährte man die Erlaubnis, sich im Königreich so gut wie unbehelligt aufzuhalten, vor allem erhielten sie Handelsprivilegien in Lyon, der führenden französischen Handels- und Industriestadt jener Zeit.
Dass die St. Galler, Basler oder Schaffhauser diese Rechte nutzten, war selbstverständlich. In diesen Städten gab es bereits Kaufleute, die sich auf den Fernhandel verstanden. In Zürich dagegen fehlte es an diesen Kenntnissen, ebenso am entsprechenden Interesse, so dass erst die Locarner erfassten, welche Goldmine hier verborgen lag. Sie war unermesslich.
Wenn die Locarner schon oft genug auf Schwierigkeiten im Herzogtum Mailand stiessen, weil sie dem falschen Glauben anhingen, so wandten sie sich jetzt umso lieber Frankreich zu, dessen Markt genauso aufnahmefähig erschien. Ohne Zürcher Bürgerrecht aber fiel das schwer, zumal die Franzosen darauf bestanden, dass nur Eidgenossen – nicht deren Untertanen wie etwa die Tessiner – in den Genuss der erwähnten Vorrechte kamen. Oft geschah es deshalb, dass ein Locarner einen Zürcher Strohmann vorschob, um in Frankreich seine Geschäfte zu erledigen. Das bedeutete Aufwand, das stiftete Abhängigkeiten, das war illegal. Um sich das zu ersparen, bemühte sich darum jeder Locarner, kaum war er heimisch geworden, um das Zürcher Bürgerrecht. Natürlich hätte ihn das auch in Italien viel besser geschützt. Doch die Zürcher wollten davon lange nichts wissen. Nur wenigen gönnte man das Privileg, und auch dann blieben Locarner noch Locarner, also Zürcher mit einem fremd klingenden Namen.
Dabei hätten die Zürcher allen Grund gehabt, den Locarnern entgegenzukommen. Denn dank ihnen setzte jetzt ein Austausch ein, der die Zürcher Wirtschaft in jeder Hinsicht belebte. Die Locarner kauften in Italien Waren ein, an denen es in der deutschen Schweiz mangelte, und sie exportierten Dinge, die sich im Süden absetzen liessen. Das alles hatte es auch früher schon gegeben. Zürich war immer mit dem Süden verbunden gewesen, was sich aus seiner geografischen Lage ergab. Doch die Locarner intensivierten den Nord-Süd-Handel in einem Ausmass wie nie zuvor. Wie immer zogen daraus beide Seiten Nutzen, wenn auch Zürich sicher mehr davon hatte. Noch lag die kleine Stadt an der Peripherie. Deshalb löste dieser Handel dort weitaus mehr aus als in Norditalien, dem Zentrum der damaligen europäischen Wirtschaft. Es setzte in Zürich ein Aufschwung ein, der streng genommen nie mehr abriss.
Betrachten wir die Baumwollindustrie. Bereits im 15. Jahrhundert hatten die Zürcher damit begonnen, Baumwolle zu Tüchli zu verarbeiten. Zwar hatte man Baumwolle schon vorher gekannt und mit Leinen zum sogenannten Barchent verwoben. Neuerdings traute man sich aber zu, Stoffe aus reiner Baumwolle zu verfertigen, grob zwar, dennoch hübsch und kleidsam, weshalb diese klein geschnittenen Tüchli sich bald grosser Beliebtheit erfreuten, vorab bei den Frauen: Sie benutzten sie gerne als Hals- oder Kopftuch. Doch bei aller Popularität: Das Tüchli blieb ein regionales Phänomen. Es wurde vorwiegend in der Stadt selbst und deren Umgebung getragen. Exportiert wurde kaum. Vielleicht boten die Weber ja nur miserable Qualität oder machten viel zu wenige Tüchli, wir wissen es nicht, jedenfalls fühlten sich die Zünfter nie bedroht. Anders ist es kaum zu erklären, warum das neue Gewerbe keinen Zunftvorschriften unterstellt wurde. Man liess es für geraume Zeit so gut wie unreguliert – bis es zu spät war, einzugreifen, weil andere, soziale Überlegungen in den Vordergrund rückten.
Denn Zwingli hatte ja den Solddienst unterbunden und damit vielen jungen Zürchern eine populäre Erwerbsarbeit entrissen. Die Schweiz zählte zu jener Zeit fast eine Million Einwohner, viel zu viele, als dass die Bauern in der Lage gewesen wären, alle zu ernähren. Die temporäre Auswanderung der jungen Männer war so gesehen unabdingbar. Als im Kanton Zürich dieser Ausweg nicht mehr offenstand, stellten sich die negativen Auswirkungen dieses politisch (oder theologisch) erzwungenen Strukturwandels gleich als drastisch heraus, insbesondere auf dem Land waren die Folgen zu besichtigen. Not brach aus. Die Behörden standen unter Druck. Kam es zu Unruhen?
In dieser heiklen Situation schien das Tüchli-Gewerbe den Zürcher Räten umso erwünschter, zumal manche Bauern auf dem Land sich längst dieser Tätigkeit widmeten. Wäre es jetzt eine gute Idee gewesen, es durch allzu engherzige Vorschriften zu ruinieren? Die Frage stellen heisst sie beantworten. Wenn das Tüchli-Gewerbe Abhilfe brachte, indem es Arbeitsplätze schuf, dann hatten die Behörden nichts einzuwenden. Sie förderten es stattdessen, weil «sich viele arme Leute in der Stadt und auf dem Land durchbringen und verbessern mögen und das Geld in das Land [in den Kanton Zürich] kommt».23
Deshalb hielten sie die Zünfte auf Distanz, ja selbst auf Abgaben und Steuern wurde verzichtet. Es gab keinen Zunftzwang, das heisst, niemand wurde gezwungen, sich einer Zunft anzuschliessen, wenn er Tüchli herstellen wollte. Ebenso wenig schrieb man «Schauen» vor, also Inspektionen, wo streng über die Qualität eines Tüchlis gewacht worden wäre, was den Behörden oder Konkurrenten stets einen Vorwand verschafft hätte, das Gewerbe zu schikanieren.
«Die Kombination von geringer Regulierungsdichte sowie Steuerfreiheit und vergleichsweise hoher Qualität», urteilt der Zürcher Historiker Ulrich Pfister, «dürfte somit die langfristige Konkurrenzfähigkeit des Zürcher ‹Tüchligewerbs› als eines der ersten ausschliesslich Baumwolle verarbeitenden Gewerbes nördlich der Alpen massgeblich unterstützt haben.»24 Jedermann konnte sich in dieser Branche versuchen. Ob sein Tüchli einen Kunden fand, lag an ihm, nicht an einer Behörde oder einer Zunft.
Das hatte Konsequenzen. Zum einen führte das liberale Regime dazu, dass viele Frauen in dieser Branche tätig wurden, selbst als Unternehmerinnen, weil keine (männlichen) Zünfter sie hinausdrängten. In den Zünften hatten Frauen in der Regel keinerlei Aussicht, je als Meisterin aufgenommen zu werden, es sei denn als Witwe eines Zunftbruders für eine begrenzte Zeit. Zum anderen liess dieser unregulierte Zustand viel mehr Innovationen zu, ob in der Produktion oder in der Arbeitsorganisation. Zum Dritten zog eine solche Branche natürlich Aussenseiter wie die Locarner an.
Zwar kümmerten sie sich kaum um die Herstellung der Tüchli, doch sie exportierten diese neuerdings nach Italien und eröffneten den Zürcher Tüchli-Webern ganz neue Perspektiven. Hatten sie vorher für die eigene Stadt und die nähere Umgebung produziert, fanden ihre Tüchli auf einmal Absatz in Bergamo, Venedig und Mailand. Denn die Locarner, die den Handel zwischen Zürich und Italien an sich brachten, waren ja darauf angewiesen, dass sie den Italienern etwas offerieren konnten, um damit andere begehrte Waren einzutauschen. Allzu viel Geld wollten sie dafür nicht einsetzen. Also verkauften sie Tüchli in Italien – und erhielten dafür Reis, Seifen, Würste, Federn, Kerzen, Waffen oder Getreide, alles Mögliche, vor allem aber brachten sie Rohstoffe zurück, die es in der Schweiz nicht gab: Baumwolle und Seide. Damit gelangten jene zwei Rohstoffe in die Stadt, die Zürichs wirtschaftliche Entwicklung für gut dreihundert Jahre bestimmen sollten.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Warum die Schweiz reich geworden ist»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Warum die Schweiz reich geworden ist» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Warum die Schweiz reich geworden ist» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.