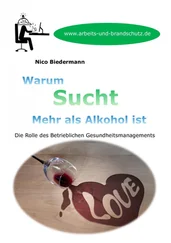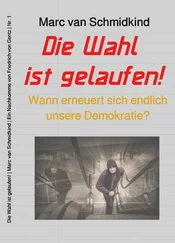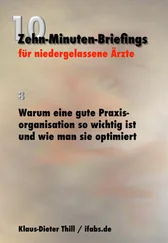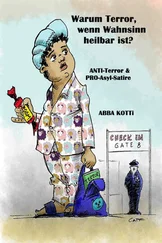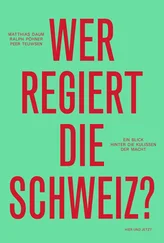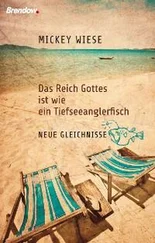Markus Somm - Warum die Schweiz reich geworden ist
Здесь есть возможность читать онлайн «Markus Somm - Warum die Schweiz reich geworden ist» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Warum die Schweiz reich geworden ist
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Warum die Schweiz reich geworden ist: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Warum die Schweiz reich geworden ist»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Warum die Schweiz reich geworden ist — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Warum die Schweiz reich geworden ist», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Man spricht zu Recht von einer Renaissance der Städte. Renaissance, weil zu Zeiten des Römischen Reiches schon viele Städte in Europa bestanden hatten, diese aber mit dem Untergang des weströmischen Teils des Imperiums weitgehend verschwunden oder zur Bedeutungslosigkeit verkommen waren. Wenige Ausnahmen – die meisten lagen in Italien – bestätigten die Regel.
Wenn manchmal vom finsteren Mittelalter die Rede war, dann entsprang dies nicht nur der Arroganz der Nachgeborenen, sondern wies auch einen wahren Kern auf: Angesichts der Tatsache, dass es für gut fünfhundert Jahre, seit dem Ende Roms, kaum mehr Städte gegeben hatte in Europa, mangelte es auch an zuverlässigen Informationen über diese lange Zeit. Denn nirgendwo wird gemeinhin mehr überliefert als in den Städten, dort stehen die Bibliotheken und Archive, sie hinterlassen sehr viel mehr historische Quellen und Artefakte als ländliche Gebiete. Ohne Zweifel war um das Jahr 500 eine Zeit angebrochen, die in mancher Hinsicht bis heute im Dunkeln bleibt, da die Zeugen der Vergangenheit schweigen. Hätten nicht die Klöster einen Teil der Archivalien aufbewahrt, wir wüssten noch viel weniger. Vor dem Jahr 1000 war Europa agrarisch. Dann begann eine Urbanisierung sondergleichen.
Woran es lag, dass seit dem 11. Jahrhundert die europäische Bevölkerung dermassen zunahm, ist in der Forschung nicht zweifelsfrei geklärt. Sicher war die Klimaerwärmung ein Faktor, die Europa von 950 bis etwa 1300 erfuhr – wärmere Temperaturen verlängerten die Anbausaison und machten die Landwirtschaft ertragreicher, infolgedessen auch mehr Menschen ernährt werden konnten. Ebenso half, dass die Europäer zu jener Zeit militärisch zulegten und es ihnen gelang, die vielen Invasoren aus dem Osten (Ungarn), Norden (Wikinger) oder Süden (Araber) ein für alle Mal abzuwehren. Das schuf stabilere politische Verhältnisse, was das Bevölkerungswachstum ebenfalls begünstigte.
Als Folge davon setzte unter anderem eine sogenannte kommerzielle Revolution ein, zusehends mehr Menschen fanden ihr Auskommen auf dem Markt, mehr Menschen waren deshalb auch imstande, sich freizukaufen. Bis ins Jahr 1000 lebten noch sehr viele Europäer als Leibeigene auf dem Land, nicht als Sklaven zwar, aber doch abhängig und kaum beweglich. Das sollte sich in den kommenden Jahrhunderten, vor allem dank des Aufstiegs der Städte, nachhaltig ändern. «Stadtluft macht frei», hiess die Losung, unzählige ehemalige hörige Bauern und Leibeigene lösten sich von ihren Feudalherren und zogen in die Stadt. Das wiederum, die Befreiung, ermutigte die Menschen, noch grössere Familien zu gründen. Es stellte sich ein Circulus virtuosus ein, oder zu Deutsch: ein Engelskreis im Gegensatz zu einem Teufelskreis. Gutes führte zu Gutem.
Wie dem auch sei, für unseren Zusammenhang ist von Belang: Je urbaner eine Gesellschaft sich ausformte, desto mehr Leute gab es, die ihre Kleider nicht mehr selber herstellten, und desto eher stieg die Nachfrage nach industriell produzierten Textilien. In den Städten wohnten mehr Menschen, die sich das leisten konnten. Dort lebten auch viele Beamte, Kleriker, Händler, Dienstboten, Soldaten, Adlige oder Handwerker, die sich selber auf eine Tätigkeit spezialisiert hatten und deshalb gar keine Zeit mehr gehabt hätten, sich um ihre Kleider selbst zu kümmern, geschweige denn noch über das nötige Produktionswissen verfügten. Mit anderen Worten, die Renaissance der Städte bedeutete auch die Renaissance der Textilindustrie in Europa. Seit dem späten Mittelalter breitete sie sich aus, wo immer sie günstige Bedingungen vorfand. So auch in der Schweiz.
Inseln des Kapitalismus in einem Meer der Landwirtschaft
Günstige Bedingungen, so stellte sich bald heraus, hiess vorweg: Den Zünften gelang es nicht, den Verlegern das Geschäft zu vergällen, ja es gab wenige Orte in Europa, wo dies den Zünften und den Behörden, auf die sie sich stützten, so gründlich misslang wie in der alten Eidgenossenschaft. Hier triumphierte am Ende die Verlagsindustrie, als hätte es nie irgendeine Zunft gegeben. Das hatte sehr viel mit den Eigenheiten dieses kuriosen Landes in den Alpen zu tun.
Damit keine Missverständnisse entstehen: Die Schweiz war keineswegs das einzige Land, wo sich in den kommenden Jahrhunderten das Verlagssystem festsetzen sollte, ganz im Gegenteil, in gewissen Gegenden war es sehr viel früher in Erscheinung getreten.
Was die Schweiz aber auszeichnete, war eine ausserordentliche Dichte an Verlegern und «verlegten» Heimarbeitern. Fast jede Region war davon betroffen, insgesamt war das Land der Hirten und Bauern spätestens im frühen 18. Jahrhundert zu einem Industrieland geworden – als dies Jacques Savary des Brûlons auffiel und er, der französische Generalinspektor des Zolles, es deshalb in seinem «Lexikon des Handels» notierte. Ein bisschen irrte er sich: Es war nicht Zürich allein, sondern ein grosser Teil der Schweiz war «Peru» geworden.
Wenn hier allerdings der Eindruck erweckt worden wäre, dass es sich beim Durchbruch des Verlagssystems um einen zielgerichteten, allgemeinen und vor allem unumkehrbaren Prozess gehandelt habe, dann gäbe dies die Realität nicht angemessen wieder. Vielmehr breitete sich diese neue, kapitalistische Produktionsweise je nach Region und Epoche unterschiedlich rasch und erfolgreich aus. Ebenso hielten sich Mischformen und Übergangsregimes, das Verlagssystem war nie eine einheitliche, gar regulierte oder alternativlose Einrichtung, keine Beschreibung wäre falscher: Sofern das Verlagssystem sich überhaupt entfaltete, stellte es die Ausnahme dar, nicht die Regel. Nur in bestimmten Regionen Europas setzte es sich durch, während die übrigen davon unberührt blieben. Zum Teil bis ins 19. Jahrhundert lebten dort die meisten Menschen von der traditionellen Landwirtschaft oder vom herkömmlichen Handwerk. Wo das Verlagssystem aber heraufzog, wälzte es die betroffenen Gesellschaften in einem Ausmass um, wie man das zuvor nie gekannt hatte.
Es waren Inseln des Kapitalismus, diese modern anmutenden Gewerberegionen in Europa, in einem Meer der Subsistenzwirtschaft. Die wichtigsten lagen zu Beginn in Italien und Flandern, später – hauptsächlich im 17. und 18. Jahrhundert – tauchte die Textilindustrie und das damit verbundene Verlagssystem auch in anderen Gebieten auf: namentlich Sachsen, in einzelnen Bezirken von Böhmen und Schlesien, ferner im Tal der Wupper, vorab in Barmen und Elberfeld (der heutigen Grossstadt Wuppertal). Weiter im Bergischen Land und am Niederrhein im Westen von Deutschland, darüber hinaus im Elsass und in Nordfrankreich. Last, but not least in England, vor allen Dingen in der Grafschaft Lancashire – und eben in grossen Teilen der Schweiz.
Alles blieb in Bewegung. Im Lauf der Jahrhunderte wandelte sich dieses grob skizzierte Bild der europäischen Wirtschaftsgeografie laufend um. Manche Regionen blieben auf Dauer konkurrenzfähig, andere verarmten, ohne dass immer ganz schlüssig zu erklären wäre, worauf dies zurückzuführen war. Aufstieg und Fall ganzer Landstriche, Triumph und Elend der Völker kennzeichneten jedenfalls die Geschichte des Verlagssystems.
Die Menschen, die daraufsetzten, wussten nie, wie lange der Aufschwung anhielt, wie lange sie von dieser frühen Industrie leben konnten. Erschien Norditalien noch im 15. und 16. Jahrhundert unübertroffen, was die Modernität seines Gewerbes anbelangte, so stieg es in der Folge ab und sollte erst im 19. Jahrhundert wieder den Anschluss finden, ein ähnliches Schicksal erlitt Flandern oder geraume Zeit später das Elsass und Schlesien, wogegen der Schweiz ein erstaunlich beständiger Erfolg beschieden war.
Oft hatte sich der Wandel wie ein Gewitter über einem Landstrich entladen, plötzlich, blitzartig änderte sich alles, manchmal lösten bloss ein paar Unternehmer das aus, wenn nicht eine einzige Person: «Im Jahr 1714 versuchte ein Glarner, seiner Magd und einigen Armen das Baumwollspinnen zu lehren; es verbreitete sich und erwuchs zuletzt zum wichtigsten Erwerbszweig des ganzen Landes»1, berichtete Johann Gottfried Ebel 1797 in seinem Reisebuch über die Schweiz.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Warum die Schweiz reich geworden ist»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Warum die Schweiz reich geworden ist» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Warum die Schweiz reich geworden ist» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.