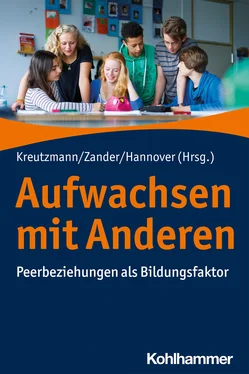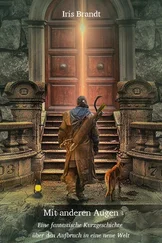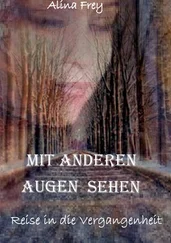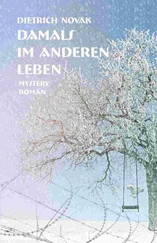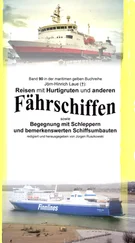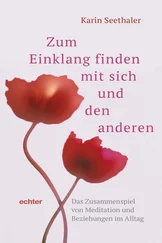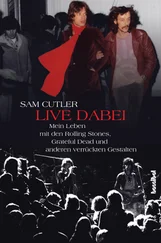Weiter können Lehrkräfte die Präferenz von Jugendlichen, Informationen mit Gleichaltrigen auszutauschen, für die Vermittlung von Lerninhalten nutzen. So kann die Lehrkraft Schülerinnen und Schüler in Lerntandems bzw. größere Lerngruppen einteilen. In diesem Zusammenhang spielt das Peer-Tutoring eine wichtige Rolle. Dieses bezieht die Peers als gleichberechtigte Wissensvermittlerinnen und Wissensvermittler mit ein, die ihren gleichaltrigen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden Lerninhalte vermitteln, mit ihnen einüben, wiederholen und ggf. nochmals erklären (Utley, Mortweet & Greenwood, 1997). Die Bedeutsamkeit des Peer-Tutorings, die Schulnoten von Schülerinnen und Schülern positiv zu beeinflussen, bestätigte sich in zahlreichen Studien (Bowman-Perrott et al., 2013). Mögliche Prozesse, die diesen Lernzuwachs erklären können, sind z. B., dass sich Schülerinnen und Schüler im Peer-Tutoring – im Vergleich zu herkömmlichen Lernsettings – eher trauen, Fragen zu stellen (Cheng & Ku, 2009).
Eine Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler mit geringerer Wahrscheinlichkeit dysfunktionale Peernormen (z. B. eine negative Einstellung zu schulischen Inhalten) übernehmen, besteht im Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern. Ergebnisse zeigten, dass sich Schülerinnen und Schüler, die sich von ihren Lehrkräften gut verstanden fühlten, weniger von der Einstellung ihrer Clique beeinflussen ließen als Schülerinnen und Schüler, die keine gute Beziehung zu ihren Lehrkräften hatten (Vollet, Kindermann & Skinner, 2017). Eine kontraindizierte Methode, um negative Einflüsse von Peernormen auf die Motivation zu reduzieren, wäre z. B. das bewusste Wegsetzen nur einzelner Schülerinnen und Schüler von ihrer Peergruppe. Zum einen werden dadurch Schülerinnen und Schüler von ihren wichtigen Bezugspersonen isoliert, was wiederum negative Auswirkungen auf ihre soziale Eingebundenheit haben kann. Zum anderen fühlen sich dadurch Schülerinnen und Schüler möglicherweise von ihren Lehrkräften weniger verstanden, was sich wiederum negativ auf die Beziehung zur Lehrkraft auswirken kann (Furrer, Skinner & Pitzer, 2014).
Zu der Frage, wie möglichst viele Schülerinnen und Schüler von einer guten sozialen Einbindung in der Klasse für ihre Motivationsentwicklung profitieren können, erbrachte eine Studie von Gest, Madill, Zadzora, Miller und Rodkin (2014) erste Hinweise darauf, dass isolierte Schülerinnen und Schüler sich nach einer Zeit besser sozial eingebunden fühlten, wenn Lehrkräfte in ihrem Unterrichtshandeln die Beliebtheit der einzelnen Schülerinnen und Schüler berücksichtigten. In diesem Zusammenhang zeigte eine Studie von van den Berg, Segers und Cillessen (2012), dass ein Neuarrangement der Sitzordnung auf Basis der Beliebtheitseinschätzung ein probates Mittel sein kann, isolierte Schülerinnen und Schüler besser zu integrieren. Es wurde dabei so vorgegangen, dass unbeliebte Schülerinnen und Schüler mit beliebten Schülerinnen und Schülern zusammengesetzt wurden. Nach der Veränderung der Sitzordnung waren Außenseiterinnen und Außenseiter besser integriert und das Klassenklima verbesserte sich ebenfalls. Diese Maßnahmen setzen allerdings voraus, dass Lehrkräfte die Peerbeziehungen in der Klasse richtig einschätzen können. Eine Studie von Harks und Hannover (2017) liefert hierzu erste Hinweise, nach denen Lehrkräfte etwa 30 % der Sympathiebeziehungen in einer Klasse korrekt einschätzen konnten. Dabei war die Einschätzungsqualität höher, wenn Lehrkräfte auch glaubten, für die Qualität der Peerbeziehungen mitverantwortlich zu sein. Eine weitere Möglichkeit, der Isolation von Schülerinnen und Schülern vorzubeugen und so präventiv einer geringen sozialen Einbindung entgegenzuwirken, ist die Einführung von Klassenregeln zum sozialen Umgang miteinander. Durch Implementation solcher Regeln können Lehrkräfte einen wertschätzenden Umgang unter den Schülerinnen und Schülern fördern (Korpershoek et al., 2016).
Die Bedeutung der Peers für die Motivation sowie den Schulerfolg Jugendlicher ist empirisch gut belegt. Dennoch ergeben sich aus den gewonnenen Erkenntnissen Fragestellungen für die zukünftige Forschung. Zum einen erscheint es zentral zu identifizieren, welche Mechanismen in welcher Altersphase besonders bedeutsam sind. Gerade der Übertritt in eine neue Schulform stellt für Jugendliche eine Umbruchsphase dar, in der sich Beziehungen zu Gleichaltrigen neu konstituieren und ausformen. Eine Frage hierbei kann sein, welche Bedeutung gerade die soziale Einbindung im Vergleich zu anderen Mechanismen, wie z. B. das Modelllernen, in dieser Phase hat. Zum anderen zeigten Ergebnisse, dass ein bedeutender Anteil an Jugendlichen scheitert, eine Freundschaft aufzubauen (DeLay et al., 2013). Fraglich bleibt hier, ob ein Teil der Jugendlichen die fehlenden Freundschaften durch eine zunehmende Unterstützung durch die Lehrkräfte bzw. außerschulische Freundschaften zu kompensieren versucht und sich dann – auch trotz fehlender Peerbeziehungen innerhalb des Klassenzimmers – positive Effekte auf die Motivationsentwicklung und den Bildungserfolg ergeben können.
• Ein Unterricht, der motivierend ist und in dem das Grundbedürfnis der Schülerinnen und Schüler nach sozialer Eingebundenheit befriedigt werden kann, erhöht die Auftretenswahrscheinlichkeit erwünschter Verhaltensweisen, die dann, wenn sie von der Lehrperson positiv verstärkt werden, auch von anderen Schülerinnen und Schülern in der Klasse übernommen werden.
• Der Einsatz von Peer-Tutoring wirkt sich günstig auf den Lernzuwachs aus, da sich Schülerinnen und Schüler im Vergleich zu herkömmlichen Lernsettings mehr trauen, Fragen zu stellen.
• Im Klassenzimmer können Peernormen bestehen, die sich ungünstig auf das Lernverhalten auswirken. Lehrkräfte können durch den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu ihren Schülerinnen und Schülern den Einfluss ungünstiger Peernormen auf die schulische Motivation reduzieren.
• Lehrkräfte können isolierte Schülerinnen und Schüler in der Klasse besser integrieren, wenn sie sich darüber bewusst sind, dass sie selbst Beziehungen unter den Peers konstruktiv mitgestalten können. Gleichzeitig können sie dadurch auch das Beziehungsnetzwerk in der Klasse besser einschätzen und isolierte Schülerinnen und Schüler identifizieren.
• Ein Neuarrangement der Sitzordnung kann helfen, isolierte Schülerinnen und Schüler zu integrieren und somit das Grundbedürfnis nach sozialer Eingebundenheit bei allen Schülerinnen und Schülern in der Klasse zu befriedigen.
• Durch die Einführung von Klassenregeln können Lehrkräfte einen wertschätzenden Umgang zwischen den Schülerinnen und Schülern fördern.
Bandura, A. (1979). Self-referent mechanisms in social learning theory. American Psychologist, 34, 439–441.
Berndt, T. J., Laychak, A. E. & Park, K. (1990). Friends’ influence on adolescents’ academic achievement motivation: An experimental study. Journal of Educational Psychology, 82, 664–670.
Bowman-Perrott, L., Davis, H., Vannest, K., Williams, L., Greenwood, C. & Parker, R. (2013). Academic benefits of peer tutoring: A meta-analytic review of single-case research. School Psychology Review, 42, 39–55.
Brown, B. B. (1990). Peer groups and peer cultures. In S. S. Feldman & G. R. Elliott (Hrsg.), At the threshold: The developing adolescent (S. 171–196). Cambridge, MA: Harvard University Press.
Cheng, Y. C. & Ku, H.-Y. (2009). An investigation of the effects of reciprocal peer tutoring. Computers in Human Behavior, 25, 40–49.
Chow, A., Kiuru, N., Parker, P. D., Eccles, J. S. & Salmela-Aro, K. (2018). Development of friendship and task values in a new school: Friend selection for the arts and physical education but socialization for academic subjects. Journal of Youth and Adolescence, 47, 1966–1977.
Читать дальше