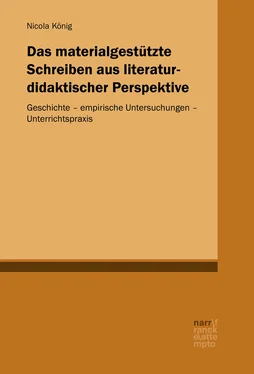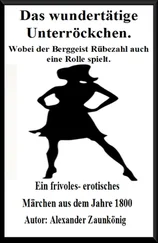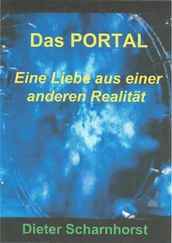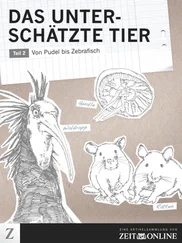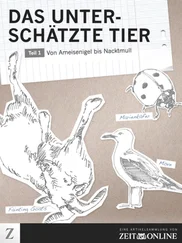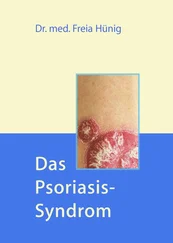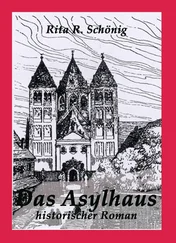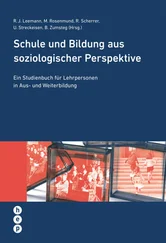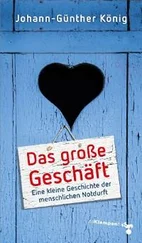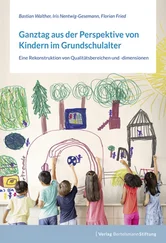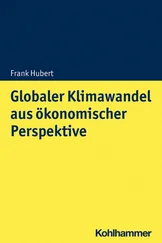Weises vorrangiges Erziehungsziel war das politische Wirken des Menschen. Er legte deshalb großen Wert auf die Verwendung des Verstandes beim Verfassen von Reden, der sowohl für das Finden von Gedanken als auch für die Verbindung der Gedanken von Bedeutung ist. Dazu griff er auf die Toplogie zurück: „Niemand kan die geringste Rede aus eigenen Kräfften aufsetzen / wen er keine Probation erdencken kan“.16 Der Rückgriff auf die aus der antiken Rhetorik bekannte Topik, die aus der Gerichtsrede hervorging,17 rückte die Lehrbarkeit des Schreibens in den Mittelpunkt. Sie kann als eine Art Stoffsammlung verstanden werden, die half, das Thema in seiner Breite und Tiefe zu erfassen. Topen sind allgemeine Gesichtspunkte, die bei der Auseinandersetzung mit einem Thema beachtet werden können. Erst nach der Sammlung des Stoffes setzte in der Disposition – die Ordnung der Gedanken – ein. Damit ist die Topik ein argumentationstheoretischer Hintergrund, mit dessen Hilfe man durch Gesetzmäßigkeiten ein Argumentationsziel erreicht. Um Auffassungen überzeugend vertreten zu können, werden Begriffsrelationen hergestellt, die den Stoff und infolgedessen auch die Argumente strukturierten. Ziel ist es, das erworbene Wissen durch thematisches Ordnen abrufen zu können.
Wie bei allen – formelhaften – Anwendungen eines Schemas, das zunächst als Unterstützung gedacht war, drohte auch bei der Umsetzung von Weises Ansatz eine Sinnentleerung des Vorgehens. So wurde der antiken Topik im Laufe ihrer Rezeptionsgeschichte eine zu starke Reglementierung und Klassifikation der Gedanken und damit eine Kleinschrittigkeit, z.B. bei der Umsetzung der Chrien form, vorgeworfen, die dafür sorgte, dass nicht die echte Erkenntnis – die Wahrhaftigkeit –, sondern nur die Ordnung und Strukturierung des Wissens und der Gedanken gefördert werde. Betrachtet man aber das Ziel, eine argumentativ überzeugende, an Adressat:innen orientierte Rede zu verfassen, dann stellt die Topik ein entscheidendes Hilfsmittel im didaktischen Prozess dar. Die Muster konnten als Gerüst verwendet werden, die eigenen Ideen zu strukturieren und argumentativ darzustellen.18 In diesem Zusammenhang können die im aktuellen Deutschunterricht im Umgang mit journalistischen Texten verwendeten W-Fragen als Abkömmlinge der Topik verstanden werden.
Weise griff aber nicht nur auf die Chrien form und die Topik zurück. Um den Schreibenden Hintergrundwissen zu vermitteln, forderte er die Schüler auf, mit Realien zu arbeiten. Dies sind Sammlungen von Notizen, Texten und Bildern – also Vorformen der Materialien, die heutzutage Schülerinnen und Schülern im Rahmen des materialgestützten Schreibens zur Verfügung gestellt werden. „Mit Hilfe der in der Topik zusammengestellten Gesichtspunkte und aus dem Material, das in den Kollektaneen zusammengetragen war, sollten die Schüler den Inhalt für ihre Ausarbeitung finden.“19 Kollektaneen20 – sogenannte Lesefrüchte – können in diesem Zusammenhang als Zusammenstellung unterschiedlicher Texte verstanden werden. Es kann sich dabei sowohl um handschriftliche Notizen oder gedruckte Artikel, um Bilder oder Aphorismen, Zitate oder ganze Texte handeln. Ebenso können eigene Beobachtungen festgehalten werden. Diese Zusammenstellungen existierten sowohl in privater als auch veröffentlichter Form. Anliegen dieses Sammelns war zunächst, Bestehendes zusammenzustellen und dadurch präsent zu machen. Dies war besonders aufgrund der Zunahme der Erkenntnisse der Wissenschaften notwendig geworden. Stötzer21 verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass Weise Realfächer im Unterricht einführte, die die Inhalte der Naturwissenschaften, aber auch der Mathematik, der Geschichte, der Geographie und der neuen Sprachen aufnahmen. Die Realien stellten damit das Material für Redeübungen, aber auch für Reden selbst dar. Sie boten demjenigen, der etwas zu einem Thema zu verfassen hatte, Inspirationen gleichermaßen wie Hintergrundinformationen. So wurden die Schüler angehalten, selber Sammlungen anzufertigen und diese in Sammelheften festzuhalten, um für unterschiedliche Anlässe Formulierungen, Versatzstücke und Ideen zur Verfügung zu haben. Gleichzeitig lernten sie, auf Materialien im Sinne von Hintergrundinformationen zurückzugreifen. „Mit Hilfe der in der Topik zusammengestellten Gesichtspunkte und aus dem Material, das in den Kollektaneen zusammengetragen war, sollten die Schüler den Inhalt für ihre Ausarbeitung finden.“22 Realien verkörpern demnach die Einsicht, dass alles Produzierte immer auf bereits Gedachtes und Geschriebenes zurückzuführen ist und damit ein Rückgriff nicht nur legitim, sondern vor allem auch sinnvoll ist.23 Damit aber erhielten die Schüler explizit eine Unterweisung im Schreiben, das nicht nur das Gliedern der argumentativen Struktur, sondern auch das Auffinden und Verwenden von Hintergrundmaterialien beinhaltete. Dieser Herausforderung muss sich eine Didaktik des materialgestützten Schreibens aktuell stellen.
Das Anfertigen von Realien beruhte demnach auf dem Prinzip der Nachahmung ebenso wie auf der Erweiterung des eigenen Horizontes. Vor allem der erste Punkt erwies sich im Lauf der Geschichte der Rhetorik als schwierig, da mit zunehmender Bedeutung und Verwendung der Realien die floskelhafte Übernahme von Ideen und Wendungen zu- und die Eigenständigkeit der Gedanken abnahm. Immer häufiger wurden die Ausführungen des Redners von Zitaten unterbrochen und es entstanden Verweiszusammenhänge, die es erschwerten, der Rede zu folgen. Der Wert des vor allem eigenständigen Anlegens von Realien aber lag unbestritten darin, den jüngeren und unerfahreneren Redeschreibern durch die Zusammenstellung von Materialien aus den verschiedensten Bereichen Inspiration zu ermöglichen und Ideen zur Horizonterweiterung anzubieten. Weiterhin erfuhren die eigenen Gedanken durch den Rückgriff auf Realien eine Kontextualisierung.
Im Hinblick auf die Einführung des materialgestützten Schreibens sind mehre Aspekte der Rhetorik Weises von Interesse: Das Erstellen von Realien und der Umgang mit diesen nimmt, ebenso wie das Einüben der Chrien form, das Vermitteln der Schreib- und Vortragskompetenz in den Blick: Aus einer Vielzahl unterschiedlicher Quellen der Realien – hier lässt sich durchaus von Polytextualität sprechen – wurden Ideen, aber auch Zitate für die eigene Rede verwendet. Diese verfolgt zwar – im Sinne einer Adressierung – eine kommunikative Funktion, fokussierte aber primär auf den Inhalt: die Sachgemäßheit. Weise bemühte sich – im Sinne Helmers’ – um eine Ausgewogenheit der drei Aspekte beim Gestalten einer Rede. Der Verweis auf die unterschiedlichen Übungsformen legt nahe, dass das Verfassen und Halten von Reden im Unterricht selbst eine zentrale Rolle spielte. Betrachtet man den Umgang der Schüler im 18. Jahrhundert mit den Realien, dann mutet ihre Eigenverantwortlichkeit im Vergleich mit der der Schüler:innen des 21. Jahrhunderts groß an. Dies betrifft besonders die aktuell geführte Diskussion um den Grad der Verbindlichkeit, welche und wie viele der zur Verfügung gestellten Materialen genutzt werden sollen.24
Der Beginn eines Deutschunterrichts
Trotz aller Innovationen, die Weises Ansätze, die deutsche Sprache zu vermitteln, enthielten, blieben diese doch weiterhin der Rhetorik verpflichtet. Und so war das Lateinische noch im 18. Jahrhundert für den Schulbetrieb und seine Organisation maßgeblich. Das betraf die Auswahl der Lektüren und der Lehrbücher ebenso wie die Durchführung von Examina. Erst mit Hiecke wurde ein dezidierter Deutschunterricht eingeführt, der sich intensiv auch mit der Vermittlung der Literatur beschäftigte. Boueke1 betont, dass man von einem Literaturunterricht, der das Verständnis literarischer Texte in den Vordergrund stellt, erst seit dem 19. Jahrhundert sprechen kann. Davor stand eine grammatische, stilistische und rhetorische Bildung im Zentrum. In den kommenden Jahrhunderten bewegte sich der Umgang mit Literatur im Spannungsfeld einer überwiegend analytischen Auseinandersetzung – als Wegbereiter lässt hier Hiecke anführen – und eines emotionalen Zugangs, bei dem Literatur Auslöser sinnlicher und emotionaler Erlebnisse ist. Konsens aber scheint trotz großer didaktischer und methodischer Unterschiede darin zu bestehen, dass der literarische Text als Gegenstand verstanden wird, der dazu geeignet ist, den Menschen zu bilden. Vor allem für die Entwicklung eines gymnasialen Deutschunterrichts und der Betonung eines interpretativen Zugangs zur Literatur hatte Hiecke einen entscheidenden Einfluss: In seiner 1842 erschienenen Abhandlung über den Deutschunterricht betont er die Bedeutung der deutschen Lektüre, die sich nicht nur durch Gehalt auszeichnen müsse, sondern auch die Basis sämtlicher unterrichtlicher Tätigkeit bilde, „für eigne inhalts- und lebensvolle Productionen, für einen interessanten und fördernden grammatischen Unterricht, und für alle sonstige theoretische und historische Belehrung, wie Metrik, Poetik und Literaturgeschichte.“2
Читать дальше