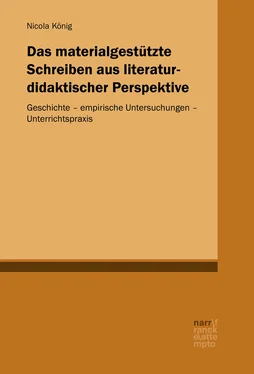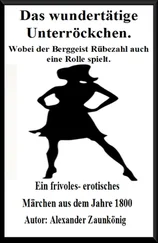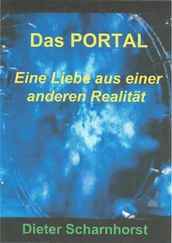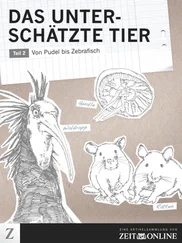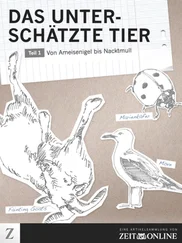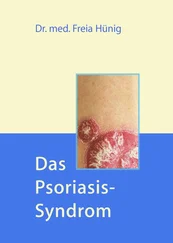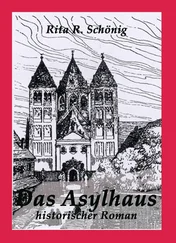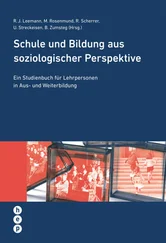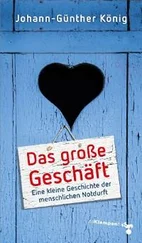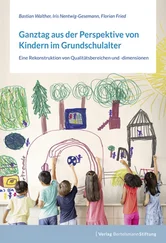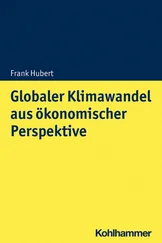Neben der Chrie , auf die im Folgenden noch näher eingegangen wird, können zwei weitere rhetorische Übungen als Vorformen des argumentierenden Schreibens im Deutschunterricht gewertet werden, die thesis und die erfundene Rede . Die thesis behandelt im Sinne einer Erörterung eine allgemein strittige Frage und untersucht das Thema argumentativ. Während bei der Chrie die Gültigkeit der These vorausgesetzt wird und der Schreibende im Zuge seiner Mitteilung die Gültigkeit ausbreitet, ist bei der thesis diese erst herzustellen. Damit rückt diese Form des Schreibens in die Nähe des Philosophierens und hat im Gegensatz zu vielen anderen Übungsformen keine klaren Adressat:innen, an die sich der Text wendet. Ludwig stellt als letzte Übungsform die erfundene Rede dar: Der Schreibende muss sich in eine Person versetzen, die die Rede verfasst. Es liegt demnach nicht nur ein Thema, sondern auch eine konkrete Situation, ein Anlass, ein Ort und damit auch ein:e Adressat:in vor. Damit weist die erfundene Rede „kommunikative Bedingungen“3 auf, die erstaunliche Parallelen zur Situierung und zum Adressatenbezug des materialgestützten Schreibens zeigen. Demnach hebt die antike Rhetorik nicht allein auf die Ausprägung eines guten Stils ab, sondern betont den argumentativen Charakter, der auf die jeweiligen Adressat:innen und die Redesituation abzustimmen ist.
Die Entwicklung des Deutschunterrichts aber ist nicht allein von der Übertragung der lateinischen auf eine noch zu entwickelnde deutsche Rhetorik gekennzeichnet. Dawidowski weist auf die Bedeutung „der Sozialgeschichte des Lesens und der Herausbildung des humanistischen Denkens im späten 18. und 19. Jahrhundert“4 hin. Ebenso veränderte sich im 17. und 18. Jahrhundert auch die Schülerschaft. Es galt zunehmend nicht nur Theologen, sondern auch Gelehrte auszubilden. Setzte sich aber das Deutsche als Unterrichtssprache zunehmend durch, dann standen weniger das Erlernen der – lateinischen – Sprache und die Nachahmung eines an der sprachlichen Richtigkeit orientierten Stils im Vordergrund. Die Auseinandersetzung mit den Inhalten gewann an Bedeutung: „Zu jedem Akt des Redens oder Schreibens gehört die Tätigkeit des Sich-Äußerns, Gedanken, Gefühle, Vorstellungen, Ansichten, kurz alles, was sich sozusagen im Kopf des Menschen befindet“5. Das Abheben auf Gefühle und Meinungen betont hier eindeutig eine kommunikative Funktion der Rede. Die rhetorische Produktion eines Textes hob auf Adressat:innen und die Wirkung, die die Rede auf diese haben sollte, ab und demonstriert die Entwicklung vom Imitations- zum Reproduktionsaufsatz.
Bei der Ausbildung einer deutschen Rhetorik spielte Christian Weise – Zittauer Schuldirektor, Verfasser von Schulkomödien und Reformator des deutschen Gymnasiums – eine maßgebliche Rolle. Als Begründer der deutschen Oratorie forderte er vom Schreibenden den Gebrauch der Vernunft ein.6 Gleichzeitig sollte der Unterricht und damit auch die zu verfassenden Reden dem Prinzip der Nützlichkeit folgen7 und den Schülern ein – berufliches – Fortkommen ermöglichen. Dies aber ging Weises Erachtens nicht durch das Abschreiben von Mustern – der Imitation –, wie es noch üblich war. Er suchte Themen aus, die die Schüler verstehen konnten und die für sie eine Bedeutung hatten; zur Gliederung des Stoffes griff er auf das antike Chrien -Konzept zurück. Die Chrie8 – auf Deutsch Bedarf, Nutzen oder Notwendigkeit – kann als in sich schlüssige Darstellung einer These verstanden werden, die Teil einer umfangreicheren Rede ist. Ihre Bedeutung, v.a. auch für die Unterweisung von Schülern, legt Weise in seinen einleitenden Worten zum dritten Kapitel Von der CHRIA dar. Es geht ihm vor allem um eine stufenweise Erhöhung der Komplexität und der Schwierigkeiten, die auch die Entwicklung des Schülers abbilden müssen.9 Die Chrie diente der Verwendung in konkreten Redesituationen und kann somit als grammatisch-rhetorische Übung verstanden werden, die die Argumentationen in zahlreiche Einzelschritte zerlegt. Das Fundament der Chrie stellt dabei die Behauptung dar, die durch einen Beweis gestützt wird. Damit steht der argumentative Kern im Mittelpunkt. Weise reduzierte die ursprünglich aus sieben Redeteilen bestehende Chrie auf vier: „potasis (das Thema der C.), aetologia (Beweis), amplificatio (Erläuterung durch contrarium, comparatum, emxemplum, testimonium) und conclusio (Schlußfolgerung)“10. Er löste sich damit von der festen Reihenfolge der Chrien form und betonte den argumentativen Teil und die Beweisführung, die die Schüler in Schulreden übten. Dadurch wurde nicht so sehr ein bestimmter Stil imitiert, denn auf der Basis eines strukturierenden Gerüsts ein eigener inhaltlicher Zugriff ermöglicht, der weniger auf die Wirksamkeit abhob, denn die Sachgemäßheit betonte. Dass die Anwendung der Chrien form in der Schule auf Dauer zu einem Formalismus geführt hat, ist nicht zu bestreiten.11 Aktuell lässt sich eine ähnliche Entwicklung beobachten, wenn man die Verwendung sprachlicher und struktureller Muster beim Erörtern beobachtet, die erstaunliche Parallelen zur Chrien form aufweisen und auch heutzutage noch dazu führen, einem Schema zu folgen, ohne die eigene Position zu benennen und kenntlich zu machen.12
Neben der Rede wurde auch die Briefform im Unterricht praktiziert, die ebenso einem festen Aufbau zu folgen hatte. Auch sie enthielt explizit einen Grund des Schreibens und damit eine Intention. Demnach kann man in diesem Kontext durchaus von einer kommunikativen Struktur und einem Adressatenbezug, d.h. einem appellativen Charakter, sprechen. Es gibt übrigens keine Hinweise dafür, dass das Verfassen von Briefen auf die unteren Jahrgänge beschränkt war, wie es heutzutage der Fall ist. So werden derzeitig Briefe in der Regel nur in den Klassenstufe 5/6 verfasst, der anspruchsvolle Charakter dieser Aufsatzform ist im aktuellen Deutschunterricht aus dem Blick geraten.13 Neben dem Verfassen von Reden und Briefen waren Gedichte die dritte Textsorte, mit der sich Schüler beschäftigten. Hier ging es weniger um die Darstellung von Empfindungen, denn um eine Erhöhung der Eloquenz, d.h. um die Ausprägung des eigenen Stils.
Ein weiterer Aspekt, der für das materialgestützte Schreiben relevant ist, fokussiert auf die Frage, wie Schüler:innen zu dem Wissen gelangen, das sie befähigt, über bestimmte Themen domänenspezifisch zu schreiben. Verbindlich kanonisierte Literaturlisten stellen eine Möglichkeit dar. Wird in den BS AHR der propädeutische Charakter, der zur Partizipation an Beruf und Studium befähigen soll, betont, dann müssen die inhaltlichen Voraussetzungen geklärt werden, um eine differenzierte Argumentation vorzunehmen zu können. Die Präsentation von Materialien im Rahmen des materialgestützten Schreibens stellt eine Realisierungsmöglichkeit dar. Wie aber gestaltete sich für Weise der Erwerb des Wissens und die Bereitstellung von Hintergrundinformationen im Rahmen der Textproduktion und des Verfassens einer Rede? Interessant in diesem Zusammenhang ist, die Themen in den Blick zu nehmen, zu denen Reden gehalten wurden. Nagel führt folgende Fächer bzw. Oberthemen an, die er nach der Reihenfolge ihrer Häufigkeit ordnet: „1. Geschichte, 2. Moral und Ethik, 3. schulische Tugenden und didaktische Fragen, 4. Philosophie, 5. Theologie, Religion und Kirchengeschichte, Gelegenheitsreden, Genealogie, Politik“14. Auffällig ist, dass kein genuin literarisches Themenfeld angeführt wird. Damit gleicht das Vorgehen deutlich stärker dem Verfassen einer Erörterung, das sich in der Mittelstufe auf allgemeine Fragen aus der Lebenswelt der Schüler:innen bezieht. Die Domänenspezifik beim materialgestützten Schreiben, die in der Oberstufe das Aufgabenformat bestimmt, dürfte sicherlich auch eine Rolle dabei spielen, dass es den Schülerinnen und Schülern schwerfällt, sich zu positionieren.15
Читать дальше