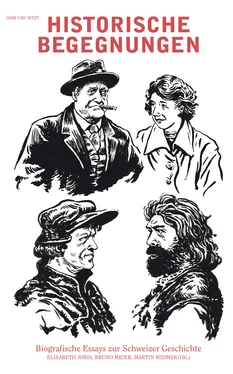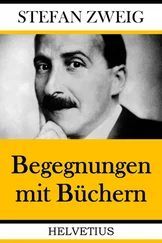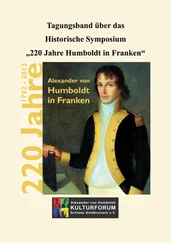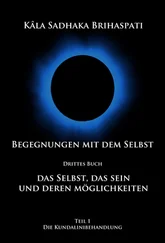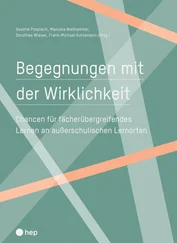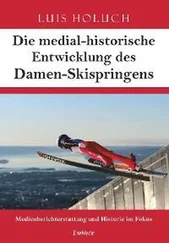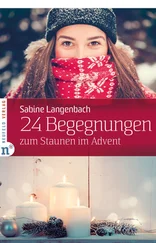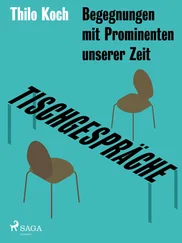Historische Begegnungen
Здесь есть возможность читать онлайн «Historische Begegnungen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Historische Begegnungen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Historische Begegnungen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Historische Begegnungen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Historische Begegnungen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Historische Begegnungen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
1521 gingen die Eidgenossen erneut ein Solddienstbündnis mit Frankreich ein. Nur Zürich beteiligte sich nicht und lieferte stattdessen dem Papst Truppen – entgegen Zwinglis grundsätzlichem Widerspruch gegen das blutige Gewerbe und seiner Kritik an den Kardinälen: «Sie tragen mit Recht rote Hüte und Mäntel. Denn schüttelt man sie, so fallen Dukaten und Kronen heraus; windet man sie, so rinnt deines Sohnes, Bruders, Vaters und Freundes Blut heraus», predigte Zwingli laut seinem späteren Nachfolger Heinrich Bullinger damals. Das war etwa ein Jahr bevor 1522 die Reformation in Zürich im eigentlichen Sinn begann – mit Zwinglis provokativer Übertretung der Fastengebote.
Seine persönliche Macht vermochte Ulrich Zwingli erst Schritt für Schritt auszubauen. Zürich galt damals noch als päpstlichste Stadt nördlich der Alpen. Auch die Leibgarde des Papstes wurde von einem Bruder eines der beiden Zürcher Bürgermeister befehligt. Dass die Zürcher Solddiensttruppen – etwa 2000 Mann – aber Ende Dezember 1521 zurückkehrten, ohne den ganzen zugesagten Sold erhalten zu haben, war mit ein Grund, weshalb Zürich schneller, als irgendwer vermutet hätte, reformatorisch wurde.
Zwingli selbst blieb stark antifranzösisch eingestellt. Es war das klar gegen Frankreich eingestellte Lager unter den Chorherren in Zürich, das ihn 1519 zum Prediger im Grossmünster bestimmt hatte, der wichtigsten Kirche der Stadt. Selbst als Zwingli vor seiner Wahl als Chorherr 1521 gestand, bislang jährlich 50 Gulden vom Papst bezogen zu haben – die Annahme fremder Gelder war in Zürich seit einigen Jahren streng verboten –, wurde ihm dies nicht weiter übel genommen.
Unmittelbarer Anlass für die Reformation war bekanntlich der Ablasshandel – gegen Bezahlung würden selbst die Sünden der bereits Verstorbenen erlassen, lautete das Versprechen. Die Kritik erstreckte sich aber schnell auf alle denkbaren übrigen Bereiche. Viele religiöse Handlungen galten auf einmal als nutzlos, schlimmer: als ein offener Betrug. Die reformatorische Generation befand, der Weg zum Seelenheil erfolge nur über die Predigt oder die Lektüre der Evangelien – des «Worts Gottes», das unverfälscht vorliege. Der Zugang zu den höchsten Wahrheiten bedürfe keiner weiteren Vermittlung. Weder den Heiligen noch den Geistlichen komme die Macht zu, das «Seelenheil» – die «Gnade» – zu sichern. Die einzelne Seele, so die neue Doktrin, könne weder durch Anbetung der Heiligen noch durch Opferhandlungen auf die Entscheidung Einfluss nehmen, ob der Himmel sich erbarme. Wie jede Revolution ergriff die Reformation fast jeden Lebensbereich.
Schon vor seiner schliesslich überstandenen Pesterkrankung 1519, die in ihm endgültig das Gefühl eines Auftrags des Himmels weckte, begann Zwingli, Vers für Vers die Evangelien durchzupredigen, und er hielt sich nicht mehr an die vom Bischof von Konstanz vorgegebene Auswahl der im Gottesdienst zu verwendenden Bibelzitate. Er konnte sich einer breiten Zustimmung sicher sein, denn er hatte sich bei der Seelsorge für die an Pest Erkrankten angesteckt. Damals nicht geflohen zu sein, wurde ihm in der Stadt hoch angerechnet.
Das Grossmünster war zu der Zeit noch ein Chorherrenstift. Zwinglis traditionalistische Gegner unter den Chorherren hielten sich anfänglich zurück. Sie machten sich erst nach dem Fastenstreit im Frühjahr 1522 laut bemerkbar. Ihre aufgelisteten Klagen wurden Zwingli zwar nicht in Zürich selbst gefährlich – im Grossmünsterstift hielt er seine Widersacher dank der Rückendeckung durch die meisten Ratsherren in Schach –, aber sie bedrohten ihn auf dem Umweg über die Eidgenossen umso mehr. Drohworte fielen, Entführungsgerüchte machten die Runde. Der Rat ordnete am 12. April 1522 eine Untersuchung an.
Luther war im Reich bereits seit Mai 1521 gebannt, und Luzern bekundete spätestens am 30. Dezember 1522 offen den Willen, die lutherischen und zwinglischen Lehren, die sich täglich weiter ausbreiteten, zu bekämpfen. Erste Massnahmen gegen die neue Predigtweise hatten die Eidgenossen an der Tagsatzung vom 27. Mai und 3. November 1522 beschlossen.
Die Verzweiflung Conrad Grebels
Schon in Frankreich, wo er von Ende 1518 bis Sommer 1520 studierte, wusste Conrad Grebel, wie problematisch die Stipendien waren, von denen er lebte. Dem Humanisten und Stadtarzt von St. Gallen, Vadian, der in Wien sein Lehrer gewesen war und seine Schwester Martha geheiratet hatte, klagte Grebel – in Latein – noch aus Paris sein ganzes Leid. Im bereits erwähnten Brief vom 14. Januar 1520 heisst es da über seinen Vater: «Er weiss nicht, was ich durch seine Schuld leide, seitdem er mich zuerst vom Kaiser und dann vom französischen König füttern lässt. Hätte er mich nur gelehrt, nach Väterart mit wenigem selbstverdienten Gelde auszukommen (ich hoffe nur, dass er von verbotenen Geschenken nichts empfangen hat), und hätte er gewollt, dass ich die Federn nicht höher strecke als das Nest, so würde mir nicht öffentlich und hinter dem Rücken Böses nachgesagt […]. Dann müsste ich nicht, wenn solche Gespräche geführt werden, bald erröten, bald erbleichen; so könnten nicht päpstliche Ritter und andere Leute immer sagen, mein Vater begünstige einseitig die Interessen des französischen Königs. […] Des Volkes Reichtum saugt der König aus und raubt ihm aus dem Munde wie ein Wolf die Nahrung, mit der ich mich glänzend ziere, im Überfluss lebe und einst, wenn das Gemeinwesen mich zu Würden und Ehren erhebt, zu Gott weiss was gezwungen werde.»
Es spricht manches dafür, dass Conrad Grebel sich im ersten Winter 1518/19 in Paris wegen des feuchten, kalten Zimmers eine Polyarthritis zuzog, auf jeden Fall klagte er noch im Juli 1521 gegenüber seinem Schwager Vadian über Gelenkschmerzen in Füssen und Händen gleichzeitig. Die kehrten mit Unterbrüchen ständig wieder. Manchmal war er für lange Tage ausserstande zu irgendwelcher Tätigkeit.
Zurück in Zürich, musste er bei Abwesenheit seines Vaters unvermeidlich in dessen Eisengrosshandelsgeschäft aushelfen. Er hatte in Paris Griechisch gelernt und las nun nebenbei weiter Epigramme, arbeitete auch an einem erläuternden Buch zu Homers Werken. Doch war er ziemlich verzweifelt, in Zürich das unabhängige Leben nicht mehr fortführen zu können. Er wünschte sehnlichst, sein Studium fortzusetzen. Der unzufriedene Vater drängte ihn zur Wahl einer Universität im päpstlichen Machtbereich, Pisa oder Bologna. Dies in Sachsen, das heisst im lutherischen Wittenberg, zu tun, blieb Conrad Grebels unerfüllbarer Wunsch. Aussicht auf ein Stipendium gab es nur von Seiten des Papstes – und solches Geld wollte Conrad Grebel nicht mehr annehmen müssen. Nicht nur wegen der causa Luther.
Eigenes Geld stand dem Vater offenbar nicht zur Verfügung, sogar seinem Schwiegersohn Vadian musste Junker Jakob Grebel die Mitgift lange schuldig bleiben. Das Eisengeschäft ging in jenen Jahren schlecht: Wegen der Pest von 1519/20 und dann wegen des Kriegs in Norditalien 1521 scheint es schwierig geworden zu sein, noch genügend Nachschub an Roheisen zu erhalten. Umgekehrt war Junker Jakob Grebel als Mitglied des Kleinen Rats zu einem seiner Geltung entsprechenden Lebensstil verpflichtet – mit Pferden für diplomatische Reisen sowie Gelagen und Geschenken zur Sicherung der periodischen Wiederwahl. Er gehörte der Konstaffel an, der Stubengesellschaft der Vornehmsten in der Stadt.
Das Geld war schon in Paris zum Hauptstreitpunkt zwischen Conrad Grebel und seinem Vater geworden. Aufgrund der Berichte über unvorsichtigen Umgang mit Geld hatte der ihm nämlich einen Teil des französischen Stipendiums – 400 Gulden – gar nicht mehr zukommen lassen. Ursprünglich erschien das als Erziehungsmassnahme. Er enthielt ihm dieses heikle Geld auch in Zürich weiter vor, vielleicht aus Angst, es würde unnötig zu reden geben und ihm als Ratsherrn in der sich 1521 zuspitzenden Auseinandersetzung um die aussenpolitische Ausrichtung der Stadt schaden.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Historische Begegnungen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Historische Begegnungen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Historische Begegnungen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.