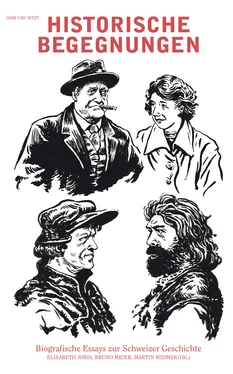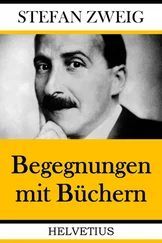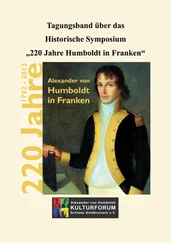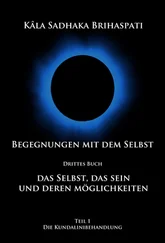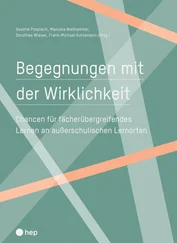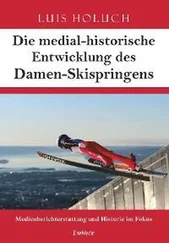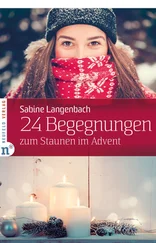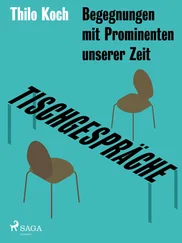Historische Begegnungen
Здесь есть возможность читать онлайн «Historische Begegnungen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Historische Begegnungen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Historische Begegnungen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Historische Begegnungen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Historische Begegnungen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Historische Begegnungen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Unterschiedliche Deutungen zweier aussergewöhnlicher Persönlichkeiten
Obwohl sich Rudolf Brun und Agnes von Ungarn auf Augenhöhe begegneten, fällt das Urteil der eidgenössischen Geschichtsschreibung mit Blick auf diese zwei aussergewöhnlichen Persönlichkeiten sehr unterschiedlich aus.
Rudolf Brun wird als der bedeutendste Politiker Zürichs im 14. Jahrhundert bewertet. Positiv wird vermerkt, dass er stets die Interessen seiner Stadt verteidigte, die Stellung der Stadt innerhalb des Reichs und gegenüber Habsburg-Österreich und den Waldstätten stärkte und eine städtische Territorialpolitik einleitete. In die Schweizer Geschichte eingegangen ist er als der Initiator des Bundes mit den Waldstätten vom 1. Mai 1351. Auch wenn eher aus der Not geboren, blieb das Bündnis für die Zukunft bedeutsam. Der Erfolg der Eidgenossenschaft im 15. Jahrhundert liegt vor allem im Zusammengehen von Städten und Ländern begründet, einem Modell, das im Reichsverband einzigartig blieb. Umgekehrt blieb Brun seiner adligen Herkunft treu, fühlte sich im Umkreis des vorderösterreichischen Adels wohler als unter den Landleuten der Innerschweiz. Und mit seinem fast diktatorisch auf seine Person zugeschnittenen Regime wurde er aus eidgenössischer Perspektive auch ambivalent beurteilt, als ehrgeiziger Emporkömmling, der wenig mit dem später so hochstilisierten demokratischen Ursprung der Eidgenossenschaft gemein hatte. Die oligarchisch geprägten Verfassungen, die keine diktatorischen Alleingänge mehr zuliessen, setzten sich in den Städten durch. In diesem Sinn war Brun eine Person des Übergangs, Vertreter einer zumindest im Raum des schweizerischen Mittellandes verschwindenden Adelslandschaft, der aber Grundlagen für die Zukunft erarbeitet hatte.
Auch Agnes von Ungarn kann in Bezug auf die Dynastie der Habsburger als Person des Übergangs betrachtet werden. Als Enkelin von Rudolf von Habsburg und Meinhard von Görz-Tirol war sie noch Teil der Generation der grossen Aufsteiger aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Sie lebte nicht mehr das Leben eines kleinen Grafengeschlechts aus dem Elsass und dem Aargau, sondern das einer Reichsfürstin mit Beziehungen in die höchsten Kreise.
In der eidgenössischen Geschichtsschreibung erfuhr die Person der Agnes eine völlig andere Beurteilung als Rudolf Brun. Sie erhielt in der Befreiungsgeschichte eine Rolle zugewiesen, die zum allergrössten Teil erfunden war: als grausame Rächerin ihres Vaters, die im Blut der Verschwörer vom 1. Mai 1308 watete. Aus der weisen wurde eine listige, aus der politisch begabten eine brutal agierende Frau. Die jüngere Geschichtsschreibung hat nachgewiesen, dass eine Beteiligung von Agnes an der Blutrache ausgeschlossen ist.
Das negative Bild aus eidgenössischer Sicht wird nicht nur aus der ihr zugeschriebenen Rolle in der Blutrache genährt. Agnes erhielt auch das Etikett der bösen Stiefmutter. Dies rührt aus dem wahrscheinlich erzwungenen Eintritt ihrer Stieftochter Elisabeth in das Kloster Töss bei Winterthur. Nachdem ein Heiratsprojekt Elisabeths mit König Wenzel von Böhmen gescheitert war und die Habsburger die Thronfolge des Karl Robert Anjou in Ungarn anerkannt hatten, hatte die ungarische Prinzessin ihre Bedeutung als politisches Pfand verloren, konnte sogar zur Hypothek werden. Ein Verschwindenlassen hinter Klostermauern war daher naheliegend. Die Chronik von Töss, wahrscheinlich im letzten Viertel des 14. Jahrhunderts entstanden, schiebt Agnes die Hauptrolle in dieser Versorgung der Stieftochter ins Kloster zu. Agnes als politischer Arm der Habsburger im Westen könnte diese Rolle durchaus gespielt haben. Allerdings förderte Agnes neben Königsfelden auch das Kloster Töss stark.
Das Bild der politischen Agnes wird in der habsburgnahen vorländischen Chronistik des 14. Jahrhunderts angedeutet – bei Matthias von Neuenburg und Johannes von Winterthur, die beide die Zeit der Agnes noch zu Lebzeiten erfuhren –, aber noch wenig herausgearbeitet. Die frühe eidgenössische Chronistik – die Chronik der Stadt Zürich und die Berner Chronik des Konrad Justinger – hebt die Schiedstätigkeit der Habsburgerin erstmals deutlich hervor. Aus dieser politisch weisen Frau wurde an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert in der eidgenössischen Geschichtsschreibung die listige und böse Frau. Die Grundlage dazu legte der Zürcher Chronist Heinrich Brennwald in seiner Chronik im Jahr 1515. Brennwald würdigt zwar noch die Schiedstätigkeit der Agnes, schreibt ihr aber eine wesentliche Rolle in der Blutrache nach 1308 zu. Brennwalds Darstellung wurde dann von Johannes Stumpf und Aegidius Tschudi noch markant ausgeweitet. Bei Tschudi wird auch ihre Tätigkeit als Schiedsrichterin negativ bewertet: Sie habe immer nur den Vorteil ihres Hauses im Blickfeld gehabt. Damit war das Bild der Agnes in der Schweizer Geschichte festgeschrieben. Erst die moderne, auf Urkunden basierende Geschichtsschreibung im 19. Jahrhundert begann das Bild zu korrigieren. Der Biograf Hermann von Liebenau schoss dabei mit seiner fast hagiografischen Lebensgeschichte 1868 über das Ziel hinaus. Die Schweizer Geschichtsschreibung Ende des 19. Jahrhunderts würdigte Agnes schliesslich als kluge habsburgische Politikerin, ein Bild, das nach wie vor gültig ist. Aus heutiger Sicht wird man zudem ihre besondere Rolle als Frau hervorheben. Aufgrund ihrer Herkunft und ihres Status konnte sie sich als eigenständige Frau in den Herrschaftsstrukturen der Zeit behaupten – auf Augenhöhe mit den Mächtigen der Zeit. Ganz wenige Frauen haben dies geschafft.
Literatur
– Boner, Georg: Königin Agnes von Ungarn. In: Brugger Neujahrsblätter 1964, 3–30. Brugg 1963.
– Boner, Georg: Die politische Wirtksamkeit der Königin Agnes von Ungarn. In: Brugger Neujahrsblätter 1965. Brugg 1964, 3–17.
– Geschichte des Kantons Zürich, Band 1, Frühzeit bis Spätmittelalter. Hg. von der Stiftung Zürcher Kantonsgeschichte. Zürich 1995.
– Kurmann-Schwarz, Brigitte: Die mittelalterlichen Glasmalereien der ehemaligen Klosterkirche Königsfelden. Corpus Vitrearum Medii Aevi Schweiz II. Bern 2008.
– Largiadèr, Anton: Bürgermeister Rudolf Brun und die Zürcher Revolution von 1336. Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Band 31, Heft 5. Zürich 1936.
– Largiadèr, Anton: Geschichte von Stadt und Landschaft Zürich, Band 1. Zürich 1945.
– Liebenau, Hermann von: Urkundliche Nachweise zu der Lebensgeschichte der verwitweten Königin Agnes von Ungarn 1280–1364. In: Argovia 5. Aarau 1866, 1–192.
– Liebenau, Hermann von: Lebens-Geschichte der Königin Agnes von Ungarn, der letzten Habsburgerin des erlauchten Stammhauses aus dem Argaue. Regensburg 1868.
– Liebenau, Hermann von: Hundert Urkunden zu der Geschichte der Königin Agnes, Wittwe von Ungar, 1288–1364. Regensbrug 1869.
– Meyer, Bruno: Die Bildung der Eidgenossenschaft im 14. Jahrhundert. Vom Zugerbund zum Pfaffenbrief. Zürich 1972.
– Nevsimal, Alfred: Königin Agnes von Ungarn. Leben und Stellung in der habsburgischen Politik ihrer Zeit. Dissertation Universität Wien. Wien 1951 (Typoskript).
– Regli, N.: Das Bild der Königin Agnes von Ungarn in der schweizerischen Geschichtsschreibung. Lizentiatsarbeit Universität Zürich. Zürich 1970 (Typoskript).
– Schneider, Jürg E.: Bürgermeister Rudolf Brun, 1336–1360. In: Geschichte der Schweiz. Fenster in die Vergangenheit I, Heft 32. Hg. von der Gesellschaft für militärhistorische Studienreisen. Zürich 2011, 73–79.
– Stettler, Bernhard: Habsburg und die Eidgenossenschaft um die Mitte des 14. Jahrhunderts. In: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, 23. Jahrgang. Basel 1973, 750–764.
– Teuscher, Simon; Moddelmog, Claudia (Hg.): Königsfelden. Königsmord, Kloster, Klinik. Baden 2012.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Historische Begegnungen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Historische Begegnungen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Historische Begegnungen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.