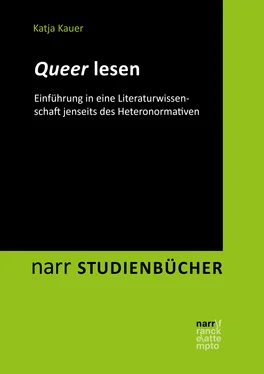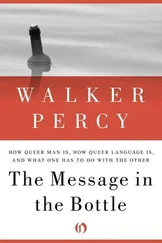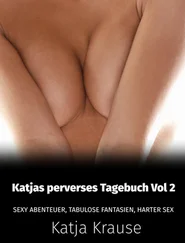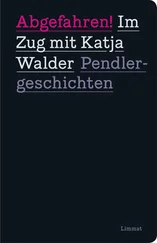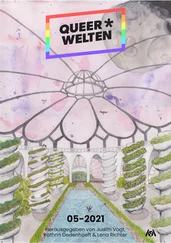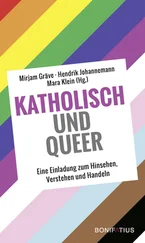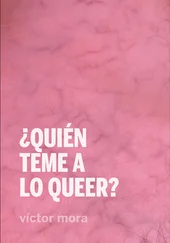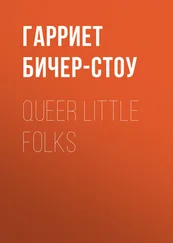Der Essay Zwangsheterosexualität und lesbische Existenz der Lyrikerin Adrienne Rich (1929–2012) allerdings kann auch im deutschsprachigen Raum auf eine über 40jährige Rezeptionsgeschichte zurückblicken. Er entstand im lesbisch-feministischen Kontext der USA der späten 1970er Jahre. Das englischsprachige Original Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence 10 wurde 1980 verfasst und 1986 in Richs Buch Blood, Bread, and Poetry: Selected Prose, 1979–1985 veröffentlicht. Die erste deutsche Übersetzung kam 1983 heraus.11 In diesem Essay wird der Begriff der Zwangsheterosexualität ( compulsory heterosexuality ) etabliert. Damit entnaturalisierte Rich das Konzept der Heterosexualität. Der Aufsatz setzt sich zum Ziel, alle etablierten Begründungen für weibliche Homosexualität, die seit Anfang des 20. Jahrhunderts bestanden haben, zurückzuweisen. Da sowohl für Männer als auch für Frauen die Mutter die erste emotionale und erotische Bindung darstelle, hinterfragt Rich die herkömmliche Psychoanalyse und argumentiert dafür, dass für Frauen die Wahl eines homosexuellen Objekts eine ganz ‚natürliche‘ sexuelle Orientierung wäre, weil sich Frauen anderen Frauen gegenüber seit der Kindheit in einem lesbischen Kontinuum bewegen. Über dieses Konzept wird im Laufe dieses Buches noch zu sprechen sein. Seine Pointe besteht darin, dass weibliche Homosexualität, falls sie von Frauen als sexuelle Präferenz gewählt würde, keinesfalls eine Diskontinuität in der Ausbildung der weiblichen Geschlechtsidentität bedeute, da die Liebe zu einer anderen Frau eine Konstante in der weiblichen Sozialisation darstelle. Der lesbische Feminismus, in dem die Frauenliebe als Wahl und nicht als pathologisch bedingte Not gelebt wurde, ist durch Richs Essay inspiriert und beglaubigt worden. Der Essay hat auch 40 Jahre nach seiner Entstehung nichts an seiner inspirativen Kraft, Beziehungen unter Frauen neu zu denken, verloren. Die Thesen sind allerdings eng in einen bestimmten politisch-feministischen Kontext eingebunden und zeigen sich nicht mehr in jeder Hinsicht als zeitgemäß. So ist nicht auszuschließen, dass in der heutigen Gegenwart Väter für die Kinder eine ähnlich bedeutende Rolle einnehmen, die damals nur den Müttern zugebilligt wurde, was Zweifel an der These aufkommen lässt, dass ausschließlich die Mutter die erste erotische Bindung eines Mädchens darstellt. Dieses Studienbuch widmet Richs Essay ein eigenes Kapitel, in dem gezeigt wird, dass sich ihre Thesen für die literaturwissenschaftliche Arbeit weiterhin als durchaus fruchtbar erweisen. Die Philosophin Monique Wittig (1935–2003) denkt noch radikaler als Rich, indem sie die Verbindung zwischen ‚weiblichem Geschlecht‘ und ‚Heterosexualität‘ hinterfragt. Ihre These besteht darin, dass der Begriff ‚Frau‘ nur in einem patriarchalisch heterosexuellen System gesetzt ist, sodass Frauen, die diesem heterosexuellen Konzept widersprechen, indem sie Männer als erotische Wahl zurückweisen, auch aus dem Begriff fallen.
Während Adrienne Rich […] zwar Heterosexualität, nicht aber Geschlecht, entnaturalisiert, geht Monique Wittig (1992) weiter und hinterfragt die Verbindung zwischen Geschlecht und Heterosexualität. Mit ihrem Zitat „lesbians are not women“ (Wittig, 1992, S. 32) führt sie die Subjektposition der Lesbe ( lesbian ) affirmativ als widerständige an. Lesben seien deshalb keine Frauen, weil ‚Frau‘ nur innerhalb des heterosexuellen Regimes Bedeutung habe […].12
Während Adrienne Richs Essay in diesem Studienbuch noch eine Rolle spielen wird, beziehe ich mich auf Monique Wittig nicht explizit. Judith Butler geht in dem von mir als Lektüreeinstieg vorgeschlagenen Aufsatz Variationen zum Thema Sex und Geschlecht. Beauvoir, Wittig und Foucault auf diese Denkerin ein. Kleiner zitiert die französische Philosophin Wittig nach dem Band The Straight Mind and Other Essays , der 1992 erschien. Der Text The Straight Mind selbst wurde jedoch bereits 1980 das erste Mal auf Englisch veröffentlicht.
Eine weitere wichtige, auch in diesem Studienbuch prominent gemachte Klassikerin des queeren Denkens ist die amerikanische Literaturwissenschaftlerin Eve Kosofsky Sedgwick (1950–2009). Übersetzungen ihrer Texte ins Deutsche sind noch nicht vollständig, im Sammelband von Andreas Kraß Queer Denken ist sie mit dem Aufsatz Epistemologie des Verstecks vertreten.13 In ihrem Buch Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire (1985)14 stellt Sedgwick dar, wie sehr die Kultur durch die homophobe Unterdrückung gleichgeschlechtlicher Beziehungen geformt ist.15 Ihre Thesen, die in diesem Studienbuch fruchtbar gemacht werden, basieren auf der Analyse von Romanen des 19. Jahrhunderts und den in diesen Texten verhandelten Männerbeziehungen. Sedgwick hat den Begriff des homosozialen Begehrens in den Genderdiskurs eingeführt. Er ermöglicht es, die affektive und emotionale Seite gleichgeschlechtlicher Beziehungen von der sexuellen Seite zu unterscheiden, was für Männerbeziehungen eine große Rolle spielt. Das Patriarchat des 19. Jahrhunderts verurteilt nämlich Homosexualität unter Männern ebenso streng, wie es Homosozialität unter Männern fördert und privilegiert. Sedgwicks Analysen stellen männliche Homophobie und den männlichen Umgang damit in den Vordergrund, indem sie zeigen, wie die gleichgeschlechtliche Sexualität zwischen Männern vermieden und heterosexualisiert wird, obwohl zwischen Männern ( between men ) ein homosoziales Begehren besteht. Wie Sedgwick diese Strategie, Homosexualität über ein trianguläres Begehren zu vermeiden, theoretisiert, werde ich in einem späteren Kapitel zusammenfassen. Andreas Kraß geht in seinem bereits erwähnten Band über Männerfreundschaft historisch weiter zurück. Er dokumentiert, wie sich erst im Verlauf der letzten Jahrhunderte die Homophobie so etablieren konnte, dass Sedgwicks Differenzierung greift, die Kraß in seiner Untersuchung ebenfalls verwendet.16 Die Literaturwissenschaftlerin Terry Castle (*1953) fokussiert die historischen Erscheinungsformen weiblicher Homosexualität, die zwar tabuisiert und ausgeblendet werden, sich jedoch anders als die der Männer seit Jahrhunderten stetig artikulieren würden.17 Ihre Analyse ist weder ins Deutsche übersetzt noch im germanistischen Bereich rezipiert worden.
Es liegt uns jedoch eine deutsche Übersetzung historischer Analysen von Frauenbeziehungen aus dem anglistischen, amerikanistischen Bereich vor, die als reiche Quelle für die Entnaturalisierung der Heterosexualität und als ein Nachweis der historisch-kulturellen Dimension von ‚Geschlecht‘ in diesem Studienbuch Erwähnung finden muss. Lilian Fadermans (*1940) Studie untersucht Frauenfreundschaften von der Renaissance bis zur Gegenwart (1981). Zwar kann auch in diesem Fall nicht von einer bereiten akademischen Rezeption die Rede sein, doch Kraß erwähnt diese Studie und nennt sein Buch über Männerfreundschaft ein Gegenstück dazu.18 Der Ansatz von Castle und Faderman unterscheidet sich insofern, als Erstere den Standpunkt vertritt, dass Homosexualität unter Frauen als Schattenbild stetig diskursiviert wurde, während die etwas ältere Forschung von Faderman dafür argumentiert, dass Frauenbeziehungen vor dem Aufkommen der Sexualwissenschaft Ende des 19. Jahrhunderts gerade nicht als sexualisiert galten. Surpassing the love of men 19 wurde 1981 in den USA und ein Jahr später in England veröffentlicht. Auf Deutsch erschien das Buch unter dem Titel Köstlicher als die Liebe der Männer. Romantische Freundschaft zwischen Frauen von der Renaissance bis heute im Jahr 1990.20 Faderman verwendet den Begriff des Queeren selbstverständlich nicht. Sie thematisiert in ihrem Buch auch nicht die Unterscheidung von Sex und Gender . Ihre historische Diskursanalyse hat aber den Effekt, das Konzept einer festen geschlechtlichen Identität zu entnaturalisieren. Somit erweist sich ihre Studie als eine phänomenologische Wurzel für das queere Denken. Faderman präsentiert anhand von Textmaterial, dass bis zur Jahrhundertwende (vom 19. zum 20. Jahrhundert) romantische Freundschaften zwischen Frauen nicht nur gang und gäbe waren, sondern zu einem Ideal erhoben wurden. Diese romantischen Freundschaften drückten sich als dermaßen starke affektive Bindungen aus, dass Faderman der Überzeugung ist, dass sie von ihren Zeitgenoss*innen (im späten 20. Jahrhundert) eindeutig als ‚lesbisch‘ klassifiziert werden würden. Diese Klassifikation ist jedoch historisch viel jünger als die Liebe unter Frauen. Das aus der Sexualwissenschaft des späten 19. Jahrhunderts stammende Konzept war im 20. Jahrhundert so popularisiert worden, dass es die Vorstellungen über Frauenliebe dominierte. Die Literaturwissenschaftlerin argumentiert dafür, dass dieselbe Art von Beziehung in früheren Jahrhunderten (dem 19. beispielsweise) als im höchsten Maße anerkannt und wünschenswert galt, im 20. Jahrhundert dann aber geächtet und gesellschaftlich abgedrängt wurde. Das habe nichts damit zu tun, dass sich die Art der Beziehung geändert hätte, sondern der Blick auf Frauen wäre für die neue Bewertung ausschlaggebend gewesen, da diese durch den männlichen Blick zunehmend sexualisiert worden waren. Weibliche Sexualität galt als bedrohlich und musste begrifflich vereinnahmt werden. Nicht die Frauenbeziehung selbst bzw. deren politische Brisanz gab den Anstoß für die beginnende Ächtung, sondern der gewandelte, von nun an sexualwissenschaftlich fundierte Blick auf diese Art der Beziehung. Während die Liebe unter Frauen davor, wie die bürgerliche Frau an sich, als entsexualisiert galt, ganz unabhängig davon, ob die romantischen Freundinnen miteinander schliefen oder nicht, ist die Frau des postfreudianischen Zeitalters sexualisiert und begehrlich, was, wie die Autorin überzeugend darstellt, sich als Männerphantasie des späten 19. Jahrhunderts erweist. Zeichen von sexueller Gier wurden auf die frauenliebende Frau in besonders starkem Maße projiziert. Die Vorstellung der von ihrem unnatürlichen, gewaltsamen ‚lesbischen‘ Begehren irregeleiteten Frau ist ein Mythos, den die Sexualwissenschaft und der Alltagsdiskurs aus der misogynen Literatur französischer Provenienz übernahmen. Das Konzept der Lesbierin entstand also im Geiste der aufkommenden Furcht vor weiblicher Emanzipation und war eher literarisch als empirisch belegt, führte jedoch dazu, dass affektive Bindungen zwischen Frauen suspekt wurden. Gewandelte Vorstellungen von Gender und neue kulturelle Konstellationen führen im Fin de Siècle zum Wandel der Bewertung von affektiven Frauenbeziehungen. Das, was vor dem Ende des 19. Jahrhunderts unsichtbar, ja unbekannt war, wurde durch die aufkeimende Sexualwissenschaft ans Licht gezerrt bzw. ‚erfunden‘ und die weiblich-weibliche Zuneigung, die ihre Karriere als sozial erwünschte romantische Freundschaft begann, wurde im 20. Jahrhundert zur Perversion, Krankheit oder Neurose erklärt.21 Die Normierung innerhalb der heterosexuellen Matrix bedeutete von nun an für Frauen, jeglichen Verdacht zu vermeiden, dass die Freundin begehrt würde.
Читать дальше