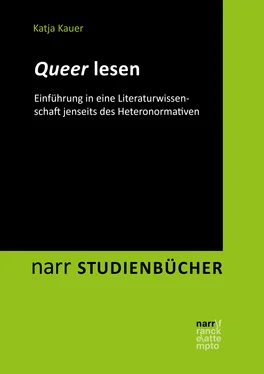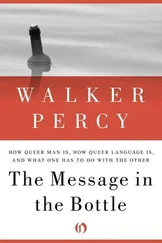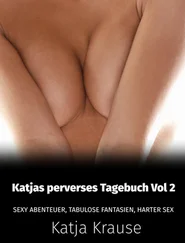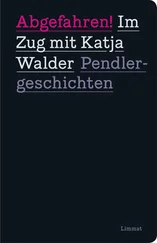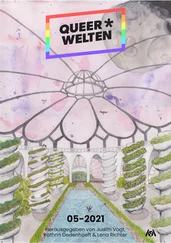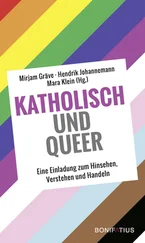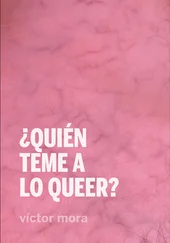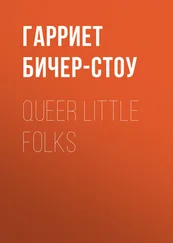Faktisch betrachtet denken und begehren wir natürlich nicht so fortpflanzungsgerichtet, wie die an der Reproduktion orientierte Logik suggeriert, selbst wenn immer wieder populärwissenschaftliche Thesen aufkommen, in denen unsere Bindung an andere Menschen mit der Fortpflanzungsorientierung erklärt und durch recht absurd anmutende Annahmen belegt werden. Ich will für diesen Diskurs, der vor allem Frauen auf ihren Status, Kinder gebären zu können, vereidigt, ein Beispiel geben.
Vor ca. 10 Jahren wurde im populärwissenschaftlichen Kontext breit diskutiert, wie sich die Einnahme hormoneller Verhütungsmittel auf die weibliche Partnerwahl auswirke. Es wurde die These aufgestellt, dass die Zugabe von Hormonen die Frauen von ihrem eigentlichen ‚Beuteschema‘ ablenke. Statt maskuliner Männer, die sie natürlicherweise eigentlich begehren, würden sie sich für femininere Männer begeistern, da ihre Psyche hormonell verblendet sei. In der Diskussion dieses Themas wird fraglos Sex als Gender gelesen, das heißt die Definition dessen, was als maskuliner (begehrenswerter) Mann und was als femininer (vom Standpunkt des natürlichen Instinkts weniger begehrenswerter) Mann gilt, obliegt allein der äußerlichen Wahrnehmung. Den Frauen, die mit der Pille verhüten, werde durch ihren Körper eine Schwangerschaft vorgegaukelt. Das führe dazu, dass sie nun keine maskulinen Partner wählen, sondern ‚weiblichere‘, ‚verweichlichtere‘ Typen bevorzugen würden. Ihre Hormonverneblung brächte eine Frau dazu, im Hinblick auf den Wunsch, ihre Nachkommen mit einem verlässlichen Mann aufzuziehen, die Objekte ihrer sexuellen Wahl zu ändern. Abgesehen von der latenten Männerfeindlichkeit dieser These, die impliziert, dass die ‚richtigen Männer‘ allein für den Sexualakt, also als ‚Samenspender‘ für Frauen interessant seien, aber für das Leben danach die weniger männlichen Typen vorgezogen werden müssten, stützte sich das Argument der Dominanz des Gender im biologischen Diskurs um Sex auf Folgendes: Obwohl es sich eigentlich um eine biologisch begründete These handeln soll, die über ‚Männlichkeit‘ und ‚Weiblichkeit‘ im Sinne von Sex reden möchte, wird doch beim Überdenken dieser Thesen klar, dass, wenn Frauen angeblich verfälscht begehren, sich dieses (falsche) Begehren bloß auf der Ebene von Gender zeigen kann. So heißt es etwa in der „Süddeutschen“: Unvernebelt, also ‚biologisch richtig‘, begehren Frauen Männer mit „ausgeprägten Gesichts- und Körperformen.“ In der Phase, in der die Pille eingenommen wird, „[s]tehen sie sonst eher auf ausgleichende, harmoniebedürftige Partner.“ Nur ohne Pille „schätzen sie […] aggressivere, konkurrierende Typen, die den Frauen selbst nicht ähnlich sind.“7 In anderen Texten, die diese Studie referierten, wurden diese „Gesichts- und Körperformen“ als kantiges Kinn, die hormonvernebelt begehrten Männer als jene mit zarterem Aussehen benannt.
Ganz bewusst habe ich ein seriöseres Medium als die Frauenzeitschrift zitiert, die mich als Erstes über die bahnbrechende Erkenntnis unterrichtete, denn auch ohne dass wir blumigere Erläuterungen über die intrinsisch begehrenswerte Männlichkeit brauchen, die eher einem Groschenroman denn einem Wissenschaftsreport entsprechen würden, sehen wir, dass das Sprechen über ‚rein biologische‘ Phänomene bereits im kulturellen Kontext verankert ist. Sowohl die Vorstellung, was ausgeprägt männliche „Gesichts- und Körperformen“ sind, die sich, wie wir wissen, durchaus nach Moden ändern können, als auch die Annahme, dass Aggression und Konkurrenz urtypisch männlich sind, während Harmoniebedürftigkeit und Ausgeglichenheit bei Männern bereits als Degenerationserscheinung gelesen werden kann, verdeutlicht, dass der Begriff vom richtigen männlichen Partner ebenso kulturell geprägt ist, wie der Begriff des Begehrens heteronormativ gesetzt ist. Argumente, die das sexuelle Verhalten auf den Reproduktionswillen zurückführen, halten sich nicht so streng an die Biologie wie es scheinen mag. Die fragwürdigen Thesen artikulieren sich innerhalb der heterosexuellen Matrix. Mir geht es in diesem Beispiel darum, zu zeigen, dass wir tatsächlich auch im Alltag unsere Aussagen über die Biologie kulturell und damit auch heteronormativ verortet haben. Die Folie, vor der diese Thesen entstanden sind, ist, dass Frauen ‚richtige Männer‘ begehren, die ihnen „selbst nicht ähnlich sind“; wenn das Begehren aber gestillt ist, weil der Körper sich nun hormonell im Zustand einer Schwangerschaft befindet, scheinen gerade diese begehrenswerten Männer nicht als die Väter zu taugen, die Frauen zum Lebenspartner wählen würden. So seien die armen, hormonell verhütenden Frauen in ihrem natürlichen Begehren gehemmt und entschieden sich gegen die Männer, denen das ‚Mannsein‘ auf den Leib geschrieben ist. Die Entscheidung, dass der richtige, also authentisch zu begehrende Mann über „ausgeprägte Gesichts- und Körperformen“ verfügen müsste, trifft aber nicht die Biologie, sondern die Kultur.
In einem 2008 erschienenen Aufsatz mit dem Titel Mann, was sind wir hart nimmt Franziska Bergmann einen im Sommer 2007 erschienenen FAZ-Artikel unter die Lupe. Der provokante Artikel Das arme Arschloch des Mannes von Baltazar Castor, der „mit althergebrachten Rollenbildern ab[rechnet]“8, bringt die Autorin dazu, „das weitestgehend unhinterfragt existierende Tabu der sexuellen Penetration des heterosexuellen männlichen Körpers“9 als Ausdruck heteronormativer Kategorien aus kulturhistorischer Sicht zu überdenken. Sie bezieht sich dabei auf die in der Männlichkeitsforschung zu einem Primärtext gewordene zweibändige Publikation Klaus Theweleits10 aus den 1970er Jahren, in der die Männlichkeitskonzeption eines gepanzerten, soldatischen Männerkörpers kritisch beleuchtet wird. Um in die heterosexuelle Matrix zu passen, untersteht der männliche Körper einer klaren Körpergrenze.11 Diese Grenze ist durch ein „Penetrationsverbot“ geschützt, was der Autor des FAZ-Artikels als kulturelles Vorurteil kritisiert. Bergmann geht in ihrer Analyse aber so weit, das Penetrationsverbot nicht als Verblendung, sondern als fest verankerte Tatsache in unseren heteronormativen Vorstellungen männlicher Körperkonzepte zu erklären. Sowohl die Körperwahrnehmung als auch die sexuellen Praktiken werden im heteronormativen Denken begrenzt und normiert.
Die Monita, die aus queerer Überlegung gegenüber den Alltagsweisheiten vorgebracht werden können, führen jedoch nicht dazu, den ‚Sinn‘ von Sexualität zu überdenken. Würde die Queertheorie anstelle der Prokreativität nun das Lustargument setzen, bliebe sie derselben Gesetzmäßigkeit verhaftet, die Sexualität mit einem natürlichen Sinn ausstattet. Ist aber nicht der ‚Sinn‘ unserer Sexualität schon längst kulturell überformt? Es geht darum, die Norm und ihre ‚Natürlichkeit‘ in Frage zu stellen, nicht darum, eine andere Norm des vielleicht besseren Begehrens, einer besseren Geschlechtsidentität ( Sex ), besseren Genders zu entwerfen, sondern zu zeigen, wie der uns so authentisch anmutende Bereich der Sexualität, wie auch unsere Körper (nicht bloß der Geist) und das dingliche Begehren dieser Körper, kulturellen Mechanismen unterliegen. Diese Mechanismen sind so wirkungsmächtig, dass sie den Blick auf eine darunter liegende Natur völlig verstellen. Kein/e Queertheoretiker*in verleugnet Natur. Aus queertheoretischer Perspektive ist sie, wie das Ding an sich bei Kant, eben einfach nicht sichtbar, denn obwohl sich Heteronormativität auf Natur beruft, ist sie auf einen mächtigen argumentativen Unterbau angewiesen, der die Vorstellung von Natürlichkeit als das Wahrhaftige in Stand setzt.
Dieser Unterbau kann in der Analyse von literarischen Texten immer wieder ins Wanken gebracht werden. Die Beschäftigung mit literarischen Texten kann einer queeren Kritik ebenso dienlich sein wie die Forschungen in empirischen Wissenschaften. Zu widersprüchlich sind die herrschenden Gendervorstellungen, als dass sie nicht permanent Uneindeutigkeiten hervorrufen würden. Interessanterweise bringen auch Texte das Phantasiebild der Heterosexualität ins Wanken, die diese eigentlich affirmieren.
Читать дальше